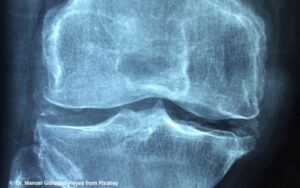Gesunde Zähne von Anfang an: Wirksame Kariesprävention für Kinder

Frühzeitige Zahnpflege, eine zuckerarme Ernährung und Fluorid schützen wirksam vor Karies und sichern die Zahngesundheit vom ersten Milchzahn an.
Die Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert. Fast 80 Prozent der Zwölfjährigen sind heute kariesfrei – ein international herausragender Wert. Diese Entwicklung zeigt: Aufklärung und Prävention wirken. Die Stiftung Kindergesundheit betont, dass eine konsequente Zahnpflege, eine zuckerarme Ernährung und der richtige Umgang mit Fluorid entscheidend sind, damit Kinderzähne gesund bleiben.
Drei Säulen der Zahngesundheit
Karies entsteht, wenn bestimmte Bakterien Zucker in Säuren umwandeln, die den Zahnschmelz angreifen. Eine wirksame Vorbeugung ruht auf drei Säulen: einer ausgewogenen Ernährung mit wenig Zucker, täglicher Mundhygiene und dem Schutz durch Fluoride. Werden diese Empfehlungen konsequent umgesetzt, lässt sich Karies vermeiden oder im Frühstadium stoppen.
1. Zuckerarme Ernährung:
Süßigkeiten und süße Getränke gehören zu den größten Risikofaktoren. Kinder sollten sie nur selten und vorzugsweise zu den Hauptmahlzeiten konsumieren, damit der Speichelfluss den Zahnschmelz schützt. Zuckerhaltige Getränke in Babyflaschen oder Trinklernbechern sollten grundsätzlich vermieden werden. Zahnschonende Produkte sind am „Zahnmännchen“-Symbol auf der Verpackung zu erkennen.
2. Regelmäßige Zahnpflege:
Bereits mit dem ersten Milchzahn beginnt die Mundhygiene. Eltern sollten ihr Kind spielerisch an das Zähneputzen heranführen. Zweimal täglich putzen – morgens und abends – ist der wichtigste Baustein gesunder Zähne.
3. Fluoridschutz:
Fluoride stärken den Zahnschmelz, hemmen die Bakterienaktivität und sind wissenschaftlich bestens untersucht. Sie wirken direkt auf der Zahnoberfläche und gelangen über fluoridhaltige Zahnpasta, Fluoridtabletten, fluoridiertes Speisesalz oder Lacke in die Mundhöhle.
Fluorid – sicher und wissenschaftlich belegt
Fluorid ist ein natürlich vorkommendes Spurenelement, das bei richtiger Dosierung unbedenklich ist. In handelsüblichen Konzentrationen – bis 1.000 ppm in Kinderzahnpasta und bis 1.500 ppm in Erwachsenenzahnpasta – ist es sicher und hochwirksam.
Empfohlene Anwendung:
- Ab dem ersten Zahn: zweimal täglich putzen mit einer reiskorngroßen Menge Kinderzahnpasta (1.000 ppm Fluorid).
- Ab dem zweiten Geburtstag: die Menge kann auf eine erbsengroße Portion erhöht werden.
- Bis sechs Jahre: weiterhin Zahnpasta mit 1.000 ppm Fluorid verwenden.
Zahnpasten mit neutralem Geschmack und kleiner Öffnung verhindern, dass Kinder zu viel verschlucken. Zusätzlich sollte in der Küche fluoridiertes Speisesalz verwendet werden – idealerweise angereichert mit Jod und Folsäure.
Früherkennung und Vorsorge ab dem ersten Zahn
Prävention beginnt früh. Schon bei den kinderärztlichen Untersuchungen U5, U6 und U7 sollten Zähne und Schleimhäute kontrolliert werden. Kinderärztinnen und -ärzte überweisen bei Auffälligkeiten an eine Zahnärztin oder einen Zahnarzt.
Die Krankenkassen übernehmen für Kinder vom 6. Lebensmonat bis zum 6. Lebensjahr sechs Früherkennungsuntersuchungen sowie zweimal jährlich Fluoridlack-Anwendungen zur Härtung des Zahnschmelzes.
Auch ältere Kinder profitieren: Zwischen dem 7. und 18. Lebensjahr werden zahnärztliche Prophylaxeprogramme angeboten. Dazu zählen Mundhygieneberatung, Ernährungsaufklärung, praktische Putzübungen, lokale Fluoridierung und auf Wunsch die Versiegelung bleibender Backenzähne.
Gemeinsame Verantwortung für gesunde Kinderzähne
„Die große Verbesserung der Zahngesundheit bei Kindern ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Prävention wirkt, wenn sie konsequent umgesetzt wird“, betont Prof. Dr. Dr. Berthold Koletzko, Vorsitzender der Stiftung Kindergesundheit. Eltern, Ärztinnen und Ärzte, pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Gesundheitseinrichtungen tragen gemeinsam dazu bei, dass Kinder mit gesunden Zähnen aufwachsen und diese Gesundheit ein Leben lang bewahren.
Giulia Roggenkamp, Stiftung Kindergesundheit