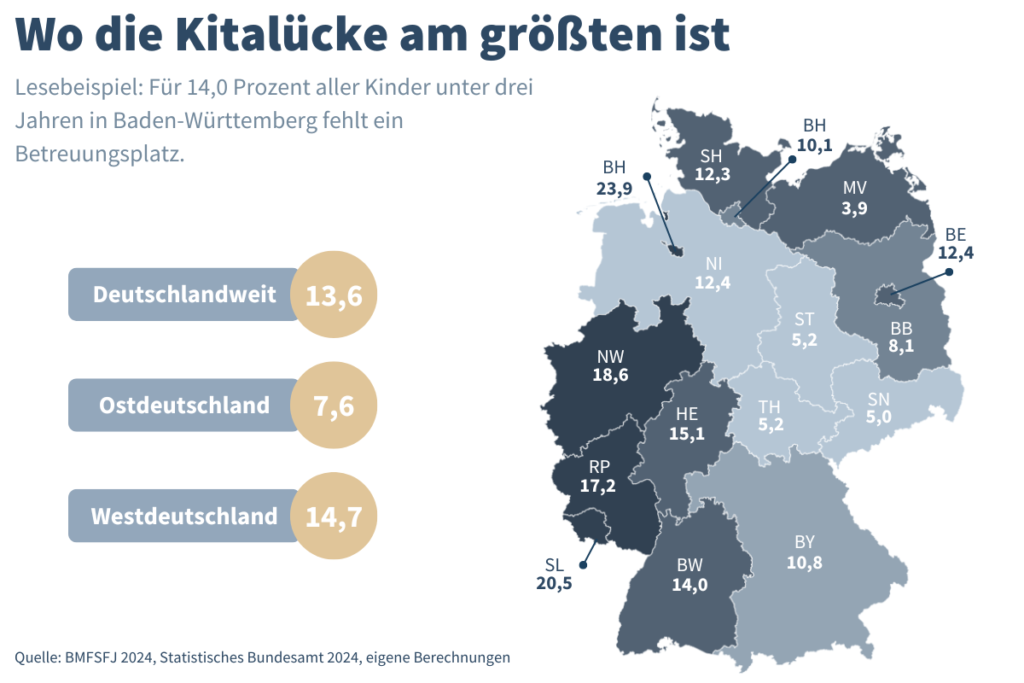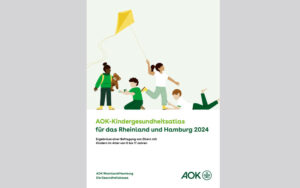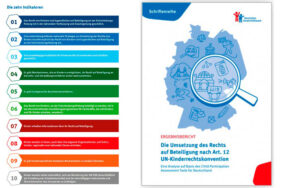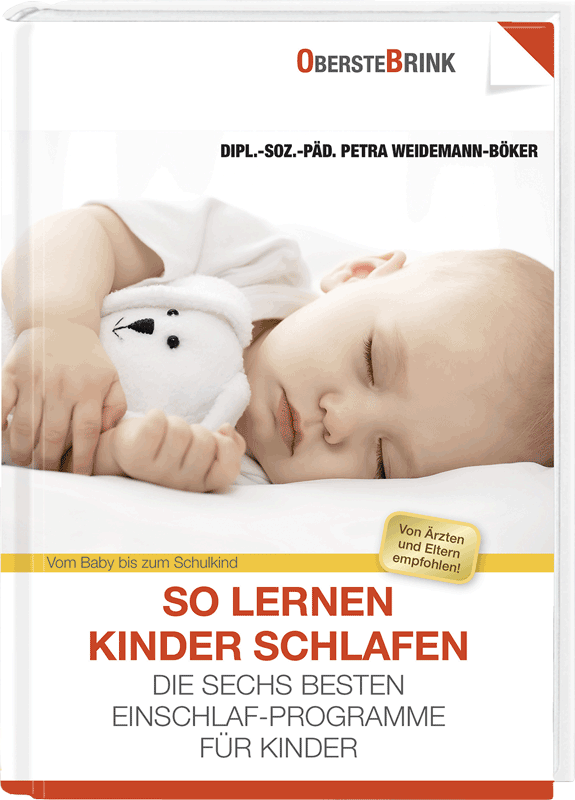Kindergesundheitsatlas bietet Einblick in das allgemeine Wohlbefinden in Kitas und Schulen
Die Gesundheit von Kindern spielt in Familien eine wichtige Rolle. Die AOK Rheinland/Hamburg hat Eltern zur Gesundheit und zum allgemeinen Wohlbefinden ihrer Kinder befragt. Im Mittelpunkt stehen dabei zehn häufige chronische Erkrankungen. Zudem blickt der Kindergesundheitsatlas auf Fragen des allgemeinen Wohlbefindens in Kitas und Schulen, aber auch auf den Medienkonsum oder den Gebrauch von Suchtmitteln.
Die Ergebnisse der repräsentativen Befragung zeigen: Viele Eltern sorgen sich um die Gesundheit ihrer Kinder, entweder weil bereits eine Erkrankung diagnostiziert wurde oder weil sie eine Erkrankung ihrer Kinder vermuten. Chronische Erkrankungen sind nicht nur für die betroffenen Kinder eine Belastung, auch die Eltern fühlen sich teilweise sehr belastet und mit der Situation überfordert. Eine frühzeitige Behandlung von chronischen Erkrankungen ist besonders wichtig, denn sie kann schweren Verläufen vorbeugen und das Risiko möglicher negativer Folgen verringern.
Kinder und Eltern sind durch Erkrankungen der Kinder belastet
Grundsätzlich schätzen 56 Prozent der befragten Eltern den Gesundheitszustand ihrer Kinder als sehr gut ein, jedoch sinkt dieser Wert deutlich, wenn bei den Kindern der Verdacht auf mindestens eine der abgefragten chronischen Erkrankungen besteht oder eine entsprechende Diagnose vorliegt (45 Prozent). Jedes dritte Elternteil, bei dessen Kind eine der abgefragten chronischen Erkrankungen diagnostiziert ist oder vermutet wird, schätzt die Belastung des Kindes (32 Prozent) sowie die eigene Belastung (34 Prozent) durch die Erkrankung des Kindes als sehr stark bzw. eher stark ein. Zudem sind Ängste und Sorgen vor der Verschlechterung einer Erkrankung (43 Prozent) oder der dauerhaften Beeinträchtigung (42 Prozent) durch eine Erkrankung sehr weit verbreitet. Fast ein Drittel der betroffenen Eltern (29 Prozent) haben Sorge, nicht ausreichend informiert zu sein oder sind nicht sicher, ob sie ihrem Kind bestmöglich helfen können. 16 Prozent der Eltern treibt die Frage um, ob sie eine Mitschuld an der Erkrankung der Kinder tragen.
„Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass wir die Gesundheitskompetenz in den Familien und besonders bei den Eltern stärken müssen. Sie brauchen einen verständlichen Überblick darüber, welche Vorsorgeuntersuchungen es gibt, wo sie gute, verlässliche Informationen über Krankheitsbilder finden und welche Verhaltensweisen gesundheitsfördernd sind“, sagt Sabine Deutscher, Vorstandsmitglied der AOK Rheinland/Hamburg.
ADHS – Eltern fürchten soziale Benachteiligung
Für den Kindergesundheitsatlas wurden 20 Diagnosen abgefragt, zehn davon wurden näher betrachtet. Darunter waren sowohl körperliche Erkrankungen als auch psychische Erkrankungen bzw. Entwicklungsstörungen. Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine der häufigsten psychischen Störungen im Kinder- und Jugendalter. Typische Symptome sind Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität, die über einen längeren Zeitraum in unterschiedlichen Lebenssituationen auftreten und den Alltag stark beeinträchtigen. Im Alltag können diese Symptome insbesondere auch im schulischen und sozialen Bereich zu Herausforderungen führen.
Vier Prozent der drei- bis 17-jährigen Kinder aus dem Rheinland und aus Hamburg haben laut den Aussagen der befragten Eltern eine diagnostizierte ADHS. Bei weiteren sechs Prozent vermuten die befragten Eltern, dass ihr Kind an ADHS erkranken könnte oder bereits erkrankt ist.
Eltern sind stark belastet
Die Zahl der vermuteten Erkrankungen liegt hier über der der bestätigten Fälle. Zugleich fällt auf, dass die Belastung der Eltern laut Befragung über der Belastung der Kinder liegt. Laut Elternaussagen ist knapp die Hälfte (49 Prozent) der Kinder mit ADHS-Diagnose und fast ein Drittel (30 Prozent) der Kinder mit vermutetem ADHS eher bzw. sehr stark belastet. Der Anteil an eher bzw. sehr stark belasteten Eltern liegt bei einer diagnostizierten ADHS bei 58 Prozent und bei vermuteter ADHS bei 44 Prozent.
Sören Schiller, Geschäftsführer der IMK GmbH – Institut für angewandte Marketing- und Kommunikationsforschung, sagt: „Die hohe Zahl der ADHS-Vermutungen und die von den Eltern stark empfundene Belastung für sich und ihre Kinder lassen auf einen hohen Informations- und Unterstützungsbedarf schließen. Hierbei sehen die befragten Eltern neben den Kinder- und Fachärzten insbesondere auch die Krankenkassen in der Pflicht. Gesundheitskompetenz und verständliche Informationen helfen Familien dabei, verlässliche Informationen und Behandlungsangebote zu finden und dadurch besser mit der Erkrankung der Kinder umzugehen.“
Adipositas – hohe Dunkelziffer – Sorge um Mitschuld
Bei der Betrachtung von starkem Übergewicht/Adipositas wurde für den Kindergesundheitsatlas nicht nur die Einschätzung der Eltern abgefragt, sondern zusätzlich wurden Gewicht, Größe und Alter der Kinder erfasst. Das Vorgehen ermöglicht methodisch einen Vergleich der Einschätzung der Eltern mit dem Ist-Zustand des diagnoserelevanten Body-Mass-Index (BMI), der sich aus Gewicht, Größe und Alter der Kinder bestimmen lässt. Dabei zeigt sich, dass mehr Kinder laut BMI adipös sind (7 Prozent) als Diagnosen vorliegen bzw. vermutet werden:
Die Zahl der Diagnosen liegt bei zwei Prozent, die der Verdachtsfälle bei 3 Prozent
Die genauere Betrachtung dieser Fälle macht deutlich, dass die Dunkelziffer wohl noch größer ist als gedacht: Von den 7 Prozent der nach BMI adipösen Kinder hat nach Angaben der Eltern nur 1 Prozent aktuell eine Adipositas-Diagnose, bei ebenfalls 1 Prozent dieser Kinder vermuten die Eltern Adipositas.
Bei den restlichen fünf Prozent der nach BMI adipösen Kinder ist nach Angaben der Eltern Adipositas weder diagnostiziert noch vermutet
Im Vergleich mit anderen Erkrankungen sind bei Adipositas die Sorgen der Eltern um eine mögliche gesellschaftliche Benachteiligung der Kinder (63 Prozent bei Diagnose/45 Prozent bei Verdacht), dauerhafte Beeinträchtigung (83 Prozent/50 Prozent) und Verschlimmerung der Erkrankung (80 Prozent/53 Prozent) besonders stark ausgeprägt. Auffällig ist auch das hohe Maß an Sorgen vor der eigenen Mitschuld an der Erkrankung des Kindes (59 Prozent bei Diagnose/38 Prozent bei Verdacht) und die Überforderung der Elternhäuser im Umgang mit der Situation (44 Prozent/30 Prozent).
„Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die Sorgen der Eltern um das Wohlergehen ihrer Kinder gerade beim Thema Adipositas sehr groß sind. Oftmals spielt auch Scham eine Rolle“, sagt Dr. Anne Neuhausen, Kinderärztin bei der AOK Rheinland/Hamburg. „Mit gesunder Ernährung, regelmäßiger körperlicher Aktivität, einer adäquaten medizinischen Begleitung und emotionaler Unterstützung stehen den Eltern adipöser Kinder eine Reihe wirksamer Mittel zur Verfügung, um die Erkrankung und ihre sozialen Folgen in den Griff zu bekommen. Es ist deshalb wichtig, Familien aufzuklären und ihnen nachhaltige und gangbare Wege aus der Situation aufzuzeigen.“
Prävention Schlüssel zur Gesundheit – Kooperation nötig
„Langfristig muss es uns gelingen, durch gezielte Gesundheitsförderung die Entstehung von Erkrankungen oder Anzeichen einer Krankheit frühzeitig abzuwenden: Prävention ist der Schlüssel zu einem gesunden Leben“, erklärt Sabine Deutscher, Vorstandsmitglied der AOK Rheinland/Hamburg. „Kinder sind unsere Zukunft und wir haben die Chance, diese bestmöglich zu gestalten. Gesundheitsförderung ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie kann nur erfolgreich sein, wenn alle zusammenwirken: Politik und Kommunen, Kindertagesstätten, Schulen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Vereine, Ärztinnen und Ärzte und Krankenkassen. Wir müssen es endlich zusammen anpacken und nachhaltige Strukturen dafür schaffen.“
Einzelbetrachtung Hamburg
In Hamburg wurden 849 Elternhäuser befragt. Dort schätzen 57,8 Prozent der befragten Eltern den Gesundheitszustand ihres Kindes als ‚sehr gut‘ ein. In der Hansestadt gaben 3,2 Prozent der Eltern an, dass bei ihrem Kind eine ADHS-Diagnose vorliegt. 6,3 Prozent der Eltern vermuten ADHS ohne bisher vorliegende Diagnose (vgl. S. 73). Damit liegt Hamburg bei den ADHS-Diagnosen leicht unter und bei den Vermutungen leicht über dem Durchschnitt der Gesamtbefragung. Bei Adipositas gaben 2,3 Prozent der befragten Eltern an, dass ihr Kind adipös sei. Die Erkrankung vermuten 1,1 Prozent der Eltern in Hamburg.
Kindergesundheitsatlas
Der Kindergesundheitsatlas der AOK Rheinland/Hamburg beruht auf einer repräsentativen Befragung von 5.000 Eltern in Rheinland und Hamburg. Durchgeführt wurde die Befragung von der IMK GmbH – Institut für angewandte Marketing- und Kommunikationsforschung. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgte durch Prof. Dr. Dr. Holger Muehlan von der HMU Health and Medical University Erfurt.
Quelle: Pressemitteilung AOK