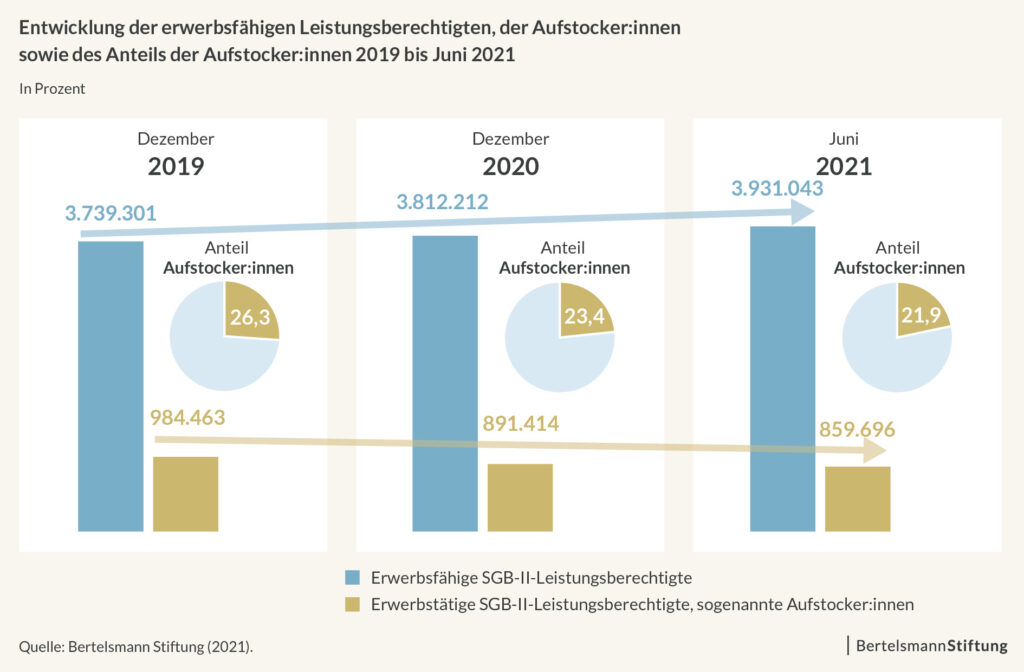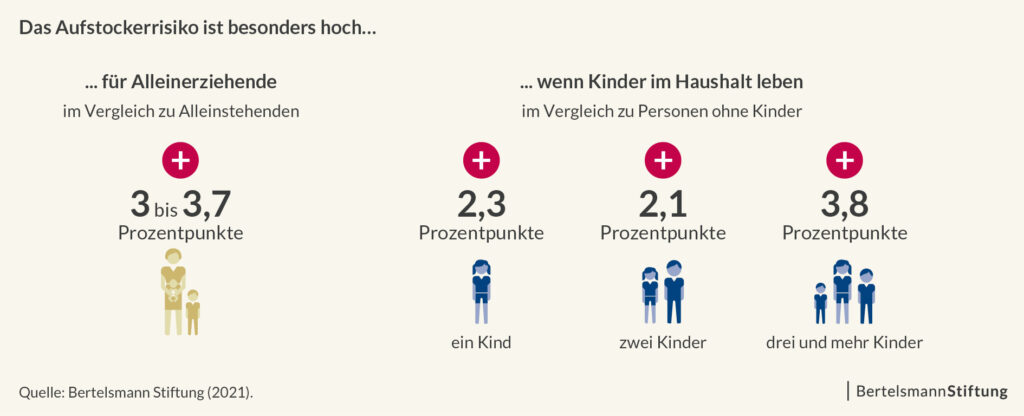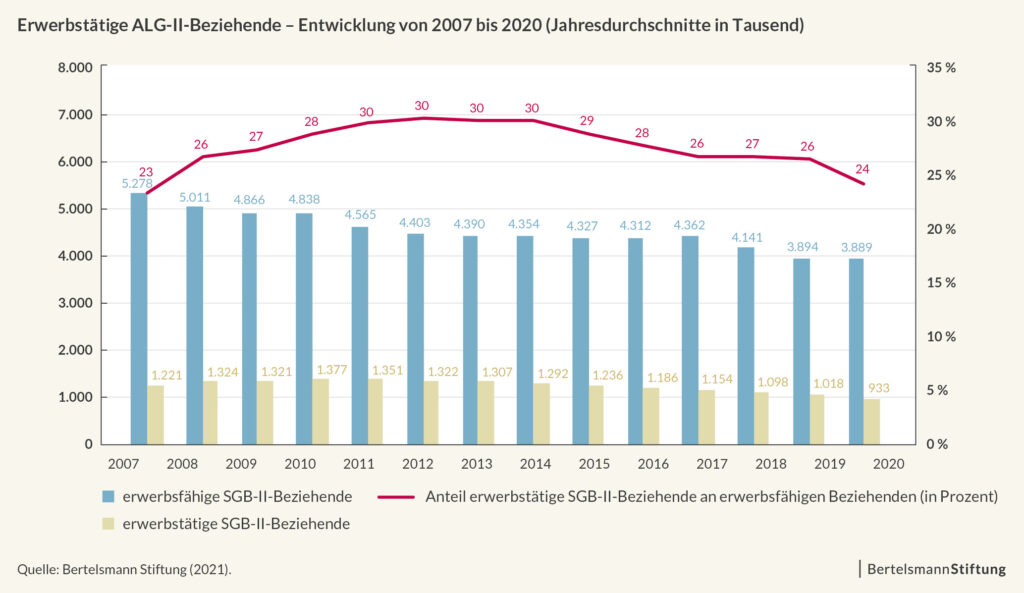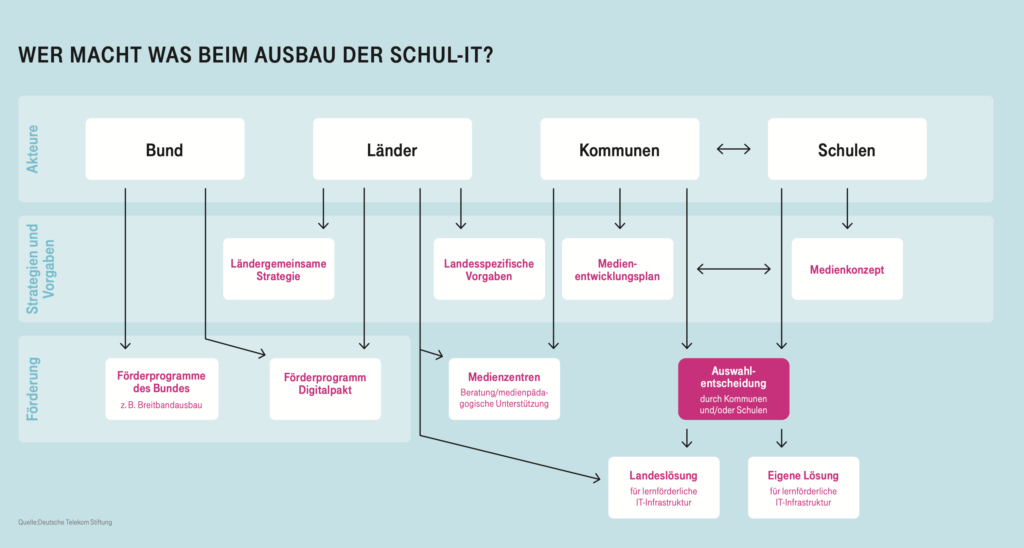Angeleitetes Spiel fördert Kinder besser als konventioneller Unterricht

Wissenschaftler der University of Cambridge analysiern das Verhalten von 3800 Kindern
Leider haben viele Menschen noch immer ein seltsames Verständnis von Lernprozessen. Das führt gelegentlich dazu, dass viele Kinder in der Grundschule unnötig „diszipliniert“ und mit den falschen Unterrichtsmethoden konfrontiert werden. Schließlich fällt es gerade den jüngeren Kindern schwer, still zu sitzen und sich auf den Unterricht zu konfrontieren.
Angeleitetes Spiel immer besser
Wie unnötig diese Quälerei sein kann, zeigt nun das Ergebnis einer Analyse, die Wissenschaftler der University of Cambridge in Großbritannien durchgeführt haben. Sie wollten wissen, ob denn nun der konventionelle Unterricht mit klarer Aufgabenstellung oder angeleitetes Spiel zu besseren Lernerfolgen führt. Dazu haben sie Studien mit rund 3800 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse der Studie, die vor ein paar Tagen im Fachmagazin „Child Development“ (https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cdev.13730) publiziert wurden, sind wenig überraschend. Sie lassen sich in etwa so zusammenfassen: Unterricht mit „angeleitetem Spiel“ fördert Kinder im Alter bis acht Jahren besser als der konventionelle Unterricht. Beim Lesen und Schreiben ist der Unterschied dabei nur gering. Beim Rechnen sind Lernerfolge erheblich größer.
Insofern wäre angeleitetes Spiel, wie es etwa der Grundschulverband (https://grundschulverband.de/) seit vielen Jahren fordert, der bessere Weg zum Lernen in der Schule.
Angeleitet und nicht frei?
Und warum muss das Spiel nun angeleitet und nicht frei sein? „Schule“, wie wir sie kennen, hat nun einmal meist etwas mit Lernzielen zu tun. Um diese zu erreichen, muss die Lehrkraft das Lernziel zumindest im Kopf haben. Das heißt jedoch nicht, dass diese auch die verschiedenen Schritte Stück für Stück vorgeben sollte. Im Gegenteil: Die Kinder sollten den Weg selbst wählen und auch ihre eigenen Schlüsse ziehen. Dass es dabei für die Lehrkräfte auch mal schwierig werden kann, wenn einige Kinder partout die falschen Schlüsse ziehen, versteht sich. Andererseits müssen sie dabei nichts anderes tun, als die Kinder erneut auf den Weg zu schicken. Entscheidend ist es, möglichst mit den Kindern fantasievolle Spiele zu entwickeln, die diese zum Lesen, Schreiben oder Rechnen auffordern.
Frühpädagogen kennen diese Prozesse schon lange. Für die Schule sei darauf hingewiesen, dass sich gerade das Theaterspiel in allen Altersstufen dazu eignet, all diese und weitere Fähigkeiten zu fördern, und dass der Mensch das Wesen ist, das sein ganzes Leben lang beim Spielen lernt.