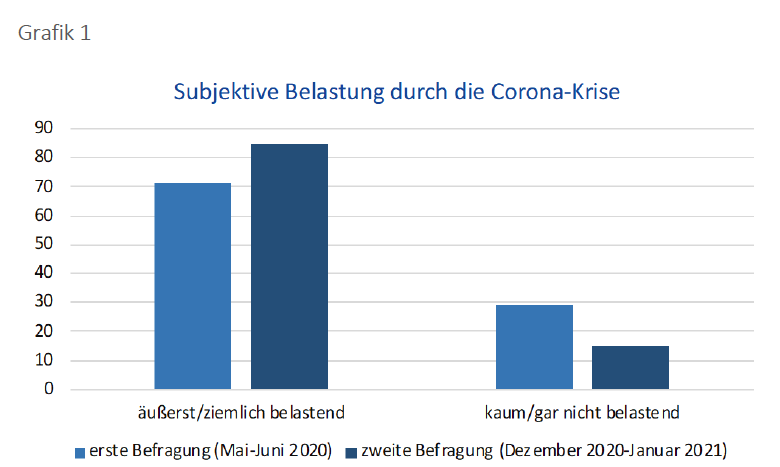UKE-Studie belegt: Hitze erhöht das Risiko für späte Frühgeburten deutlich

Ab 35 Grad Celsius steigt das Risiko einer Frühgeburt um 45 Prozent
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) haben festgestellt, dass Temperaturen über 35 Grad Celsius das Risiko einer Frühgeburt um bis zu 45 Prozent steigern können. Aus mehr als 42.000 Patientinnenakten das Team um die Professorinnen Petra Arck und Anke Diemert aus der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin des UKE anonymisierte Daten von Schwangeren, die in den vergangenen 20 Jahren im UKE entbunden haben, analysiert. Die Forschenden verglichen dabei die errechneten sowie tatsächlichen Geburtstermine mit den Klimatabellen des Hamburger Wetterdienstes.
Dabei konzentrierten sie sich auf die jährlichen Perioden zwischen März und September, in denen außergewöhnlich hohe Temperaturen herrschten. Demzufolge führt Hitzestress von 30 Grad Celsius zu einer Erhöhung des Frühgeburtsrisikos um 20 Prozent. Temperaturen über 35 Grad können das Risiko sogar um 45 Prozent steigern.
„Auffällig war, dass die werdenden Mütter ein bis zwei heiße Tage offensichtlich überbrücken konnten. Folgte aber ein dritter, vierter, fünfter Tag ohne Abkühlung, setzten vermehrt vorzeitige Wehen ein. Und zwar besonders dann, wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit das gefühlte Wärmeempfinden noch erhöhte“, erläutert Studienleiterin Prof. Dr. Petra Arck, gleichzeitig Forschungsdekanin der Medizinischen Fakultät des UKE.
Aktuell sichtet das Forschungsteam die Klima-Prognosen der kommenden zehn Jahre. 2033 könnte aufgrund steigender Temperaturen annähernd jedes sechste Kind, rund 15 Prozent, zu früh geboren werden – doppelt so viele wie heute. Prof. Arck: „Welche Folgen das für die Gesundheit der Neugeborenen hat, ist bislang noch nicht absehbar.“
Jeder Tag zu früh ein Risiko für spätere Gesundheitsprobleme
Im medizinischen Sinne handelt es sich immer dann um eine Frühgeburt, wenn das Baby vor vollendeter 37. Schwangerschaftswoche geboren wird. Von einer späten Frühgeburt spricht man zwischen der 34. bis 37. Schwangerschaftswoche. „Etwa jedes zwölfte Kind kommt vor dem errechneten Termin zur Welt“, sagt Prof. Dr. Anke Diemert, die in der Klinik für Geburtshilfe schwangere Frauen betreut und den Studiengang Hebammenwissenschaft im UKE mit verantwortet. „Eine Geburt vor der 37. Schwangerschaftswoche geht mit einem erhöhten Risiko für gesundheitliche Probleme im späteren Leben einher. Hier zählt jeder Tag“, erklärt sie. So müssen unter anderem die Lungen, das Verdauungs- und Immunsystem noch reifen. Konzentrationsstörungen, schlechtere Schulleistungen, ein höheres Risiko für Infektionen, Allergien, Asthma und Übergewicht können Studien zufolge Konsequenzen einer Frühgeburt sein.
Hitze beeinträchtigt Versorgung des Ungeborenen mit Sauerstoff und Nährstoffen
Herrschen draußen tage- oder wochenlang extrem hohe Temperaturen, ist die Situation für die werdende Mutter extrem belastend: Weil der Bauch auf die Hauptvene drückt, kommt am Herzen nicht mehr so viel Blut an. Durch die Dauerhitze weiten sich die Blutgefäße und verstärken diesen Effekt. Eine solche hitzebedingte Gefäßerweiterung beobachten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch in der Gebärmutter, was die Versorgung des heranwachsenden Babys mit Sauerstoff und Nährstoffen beeinträchtigt.
In schwülen Nächten erhöht zudem fehlender Schlaf den Stress. Parallel sinken die Schwangerschaftshormone, der Cortisolspiegel steigt – und auch das Risiko einer Frühgeburt.
Was also tun bei Hitze-Stress? „Frauen, die sich zwischen der 34. und 38. Schwangerschaftswoche befinden, sollten bei anhaltend hohen Temperaturen möglichst die Sonne meiden, sich in klimatisierten Räumen aufhalten sowie viel Flüssigkeit zu sich nehmen“, lautet die Empfehlung von Prof. Arck.
PRINCE-Studie erforscht vorgeburtliche Prägung
Seine Forschungsergebnisse hat das Team unter anderem im Rahmen der Langzeitstudie PRINCE (Prenatal Identifiction of Children‘s Health) gewonnen. Seit 2011 wird im UKE erforscht, wie sich der Lebensstil einer werdenden Mutter auf die spätere Gesundheit ihres Kindes auswirkt. Mehr als 800 Schwangere haben bisher an den Untersuchungen zur vorgeburtlichen Prägung teilgenommen. Die ersten Kinder sind inzwischen zehn Jahre alt. Ziel ist es, molekulare Mechanismen zu entschlüsseln, mit denen bereits vor der Geburt die Grundlagen für mögliche spätere Erkrankungen gelegt werden. Aufbauend auf diese Erkenntnisse sollen dann Präventionsstrategien entwickelt werden. Weitere Infos: www.uke.de/prince.
Originalpublikation:
Dennis Yüzen et. al., Increased late preterm birth risk and altered uterine blood flow upon exposure to heat stress, EBIOMedicine, 2023. DOI: https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(23)00216-5/fulltext
Saskia Lemm, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf