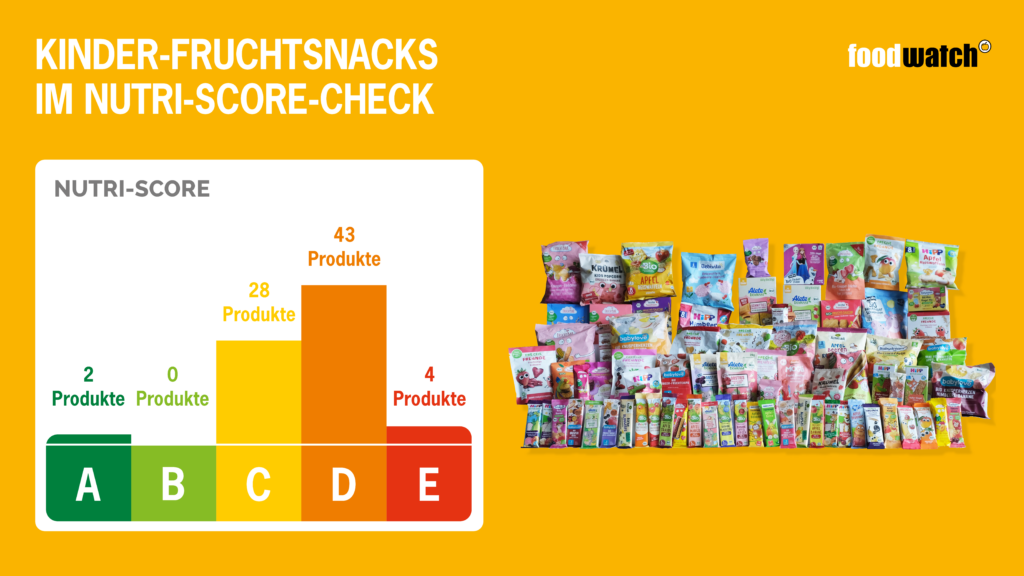Hautkontakt nach der Geburt: Kuscheln stärkt Babys Gesundheit

Neuer Cochrane Review zeigt: Wenn Babys nach der Geburt auf die nackte Brust der Mutter gelegt werden, starten sie gesünder ins Leben
Einfach, kostenlos und wirksam: Wenn ein gesundes Neugeborenes innerhalb der ersten Stunde nach der Geburt auf die unbedeckte Brust seiner Mutter gelegt wird, profitiert es gleich mehrfach. Laut einem aktuellen Cochrane Review fördert dieser unmittelbare Hautkontakt das Stillen und stabilisiert wichtige Körperfunktionen des Babys.
Rund 82 Prozent der Neugeborenen mit Hautkontakt wurden in den untersuchten Studien mindestens sechs Wochen lang voll gestillt – manche sogar bis zu einem halben Jahr. Ohne Hautkontakt lag die Stillquote nur bei 59 Prozent. Zudem hatten die Babys im Hautkontakt bessere Vitalwerte, etwa bei Körpertemperatur, Blutzucker, Atmung und Herzfrequenz.
Was früher Routine war, gilt heute als überholt
„Früher wurden Babys direkt nach der Geburt für Untersuchungen, Wiegen oder Baden von ihren Müttern getrennt. Das verhinderte einen frühen Haut-zu-Haut-Kontakt“, erklärt Elizabeth Moore, Erstautorin des Cochrane Reviews und emeritierte Professorin an der School of Nursing der Vanderbilt Universität (USA).
Dabei ist es längst erwiesen, dass das erste Kuscheln nicht nur emotional, sondern auch medizinisch wertvoll ist. Trotzdem ist es selbst in gut ausgestatteten Kliniken noch keine Selbstverständlichkeit.
Warum Cochrane von „wahrscheinlich“ und nicht von „sicher“ spricht
Cochrane Reviews gelten als Goldstandard der evidenzbasierten Medizin. Trotzdem formulieren die Forschenden vorsichtig: Der Hautkontakt wirkt „wahrscheinlich“ positiv – nicht „sicher“.
Der Grund liegt in den untersuchten Studien: Mütter wussten, ob sie ihr Baby direkt bekamen oder nicht. Das konnte ihr Stillverhalten beeinflussen. Solche methodischen Grenzen schmälern die Beweiskraft – ändern aber nichts daran, dass der Effekt klar erkennbar ist.
Hautkontakt gilt heute als ethischer Standard
Die Autorinnen und Autoren kommen zu einem deutlichen Schluss: Weitere randomisierte Studien, die Müttern und Babys den Hautkontakt vorenthalten, wären unethisch.
„Es gibt ausreichende Evidenz, dass der direkte Hautkontakt die Gesundheit und das Überleben von Neugeborenen verbessert“, betont Karin Cadwell, Senior-Autorin und Leiterin des Healthy Children Project’s Center for Breastfeeding in den USA.
Besonders in Ländern mit geringem Einkommen kann Hautkontakt lebensrettend sein. In einer großen Studie in Indien und mehreren afrikanischen Ländern wurde die Untersuchung sogar vorzeitig beendet – weil sich zeigte, dass Babys mit Hautkontakt signifikant häufiger überlebten.

Blickkontakt und Bindung formen das Gehirn
Dr. Walter Hultzsch erklärt, wie Nähe, Blickkontakt und feine Signale die Entwicklung von Aufmerksamkeit, Selbstregulation und Persönlichkeit von Säuglingen fördern. Sein Buch verbindet neurowissenschaftliches Wissen mit alltagstauglicher Orientierung für Eltern, Großeltern, Paten und pädagogische Fachkräfte, die Babys in den ersten Lebensjahren achtsam begleiten wollen.
Dr. Walter Hultzsch
Hey Mama, schau mir in die Augen – und sprich mit mir – Bindung, Blickkontakt & frühe Kommunikation – wie sie das Gehirn deines Babys formen
120 Seiten, ISBN: 9783963040726, 20 €
Mehr zum Buch
Update mit 69 Studien: Evidenz klar, Praxis hinkt hinterher
Der aktuelle Review aktualisiert eine Übersicht von 2016, die bereits in 20 internationale Leitlinien eingeflossen war – darunter in die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Mit 26 neuen Studien umfasst die Analyse nun 69 Untersuchungen mit über 7.000 Mutter-Kind-Paaren. Die meisten stammen aus Ländern mit hohem Einkommen; in Ländern mit niedrigem Einkommen fehlen Daten.
Die Autor*innen empfehlen daher, künftig vor allem die Umsetzung in der Praxis zu verbessern – also sicherzustellen, dass Hautkontakt nach der Geburt überall selbstverständlich wird.
Was ist Cochrane?
Cochrane Deutschland mit Sitz in Freiburg ist Teil der internationalen, gemeinnützigen Cochrane Collaboration. Das Netzwerk aus unabhängigen Forschenden erstellt systematische Übersichtsarbeiten – sogenannte Cochrane Reviews – zu medizinischen und gesundheitlichen Fragen. Ziel ist es, die weltweite Studienlage zu bewerten und so eine verlässliche Grundlage für Gesundheitsentscheidungen zu schaffen.
Seit seiner Gründung 1993 hat Cochrane weltweit bereits rund 9.500 Reviews veröffentlicht.
Für Eltern und Fachkräfte
Der direkte Hautkontakt nach der Geburt ist mehr als ein schönes Ritual – er ist eine einfache, wissenschaftlich belegte Maßnahme, um das Wohlbefinden und die Gesundheit von Mutter und Kind zu stärken.
Kuscheln nach der Geburt kostet nichts, braucht keine Technik – nur Nähe, Wärme und Zeit.
Originalpublikation:
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003519.pub5