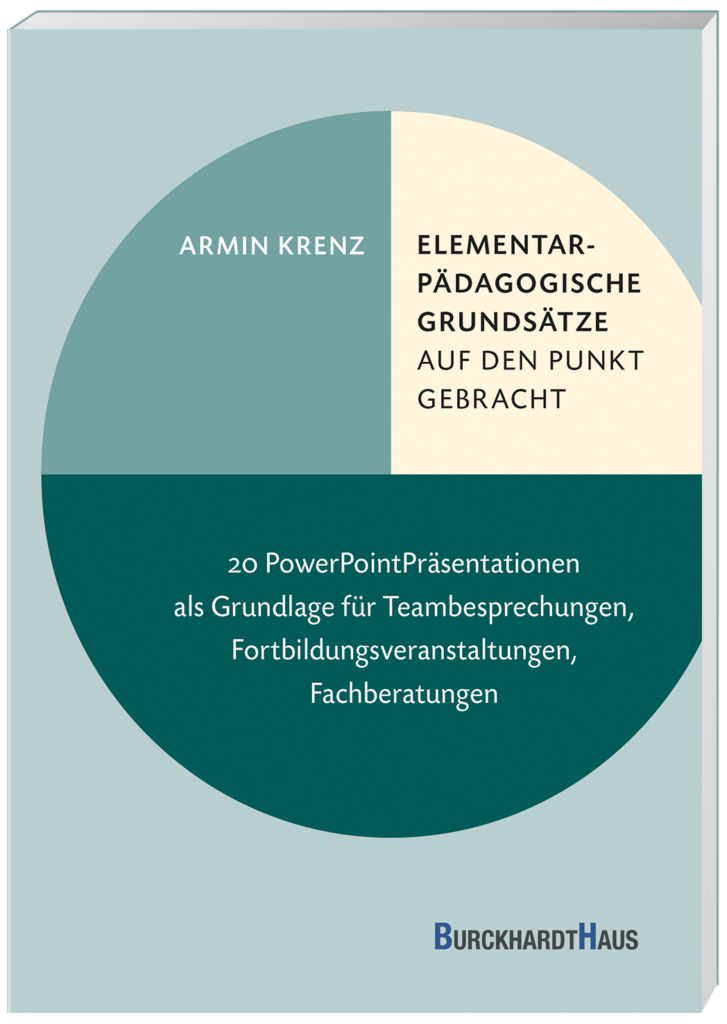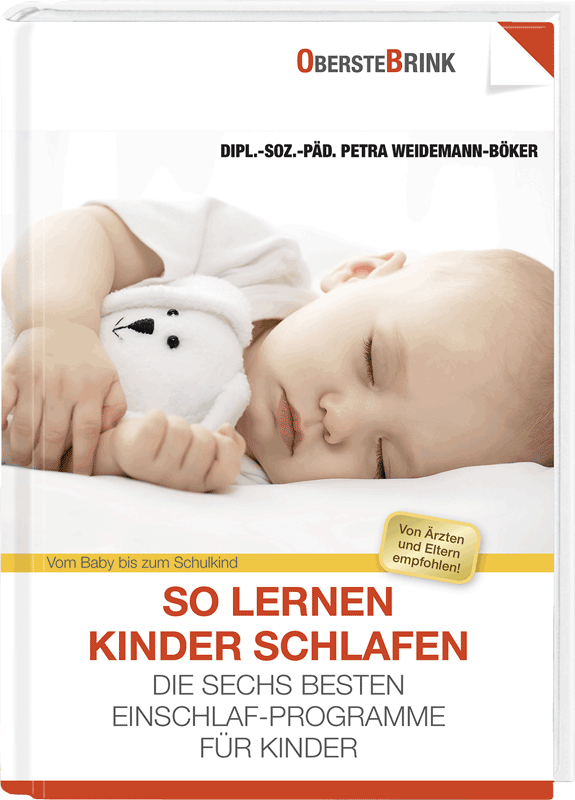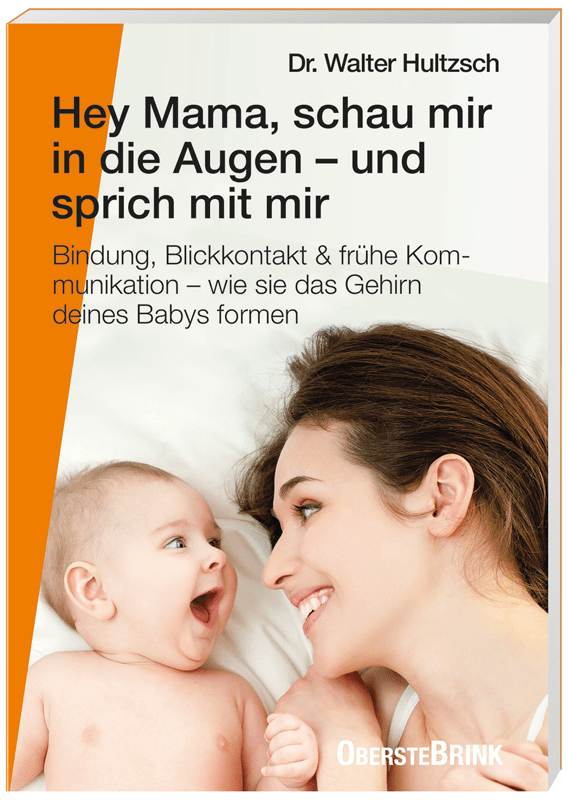Fachtag zu Beschäftigungspotenzialen in Kitas 2026

Wie können Arbeitszeiten stabilisiert und Fachkräfte entlastet werden? Jetzt kostenfrei zum Fachtag am 1. April 2026 in Dresden anmelden
Viele Erzieherinnen erleben es täglich: hohe Belastung, Personalmangel, ständig neue Anforderungen. Gleichzeitig arbeiten fast die Hälfte der pädagogischen Fachkräfte in Teilzeit – oft nicht freiwillig, sondern um die Arbeit langfristig bewältigen zu können.
Genau hier setzt der Fachtag
„Beschäftigungspotenziale in der Kindertagesbetreuung – Ergebnisse, Herausforderungen, Perspektiven für Ostdeutschland“
am 1. April 2026 in Dresden an.
Im Mittelpunkt steht die Frage:
Wie können Arbeitsbedingungen so verbessert werden, dass Fachkräfte im Beruf bleiben – und vielleicht sogar ihre Stunden aufstocken?
Worum geht es beim Fachtag?
Auf dem Fachtag werden erste Ergebnisse des bundesweiten Forschungsprojekts BeKit vorgestellt. Dieses untersucht, warum viele Fachkräfte ihre Arbeitszeit reduzieren oder nicht auf Vollzeit erhöhen – und welche Rahmenbedingungen sich ändern müssten.
Gemeinsam mit Fachkräften aus der Praxis wird diskutiert:
- Wie können bestehende Arbeitszeiten stabilisiert werden?
- Welche Unterstützung brauchen Erzieherinnen im Alltag wirklich?
- Was können Träger und Politik konkret verbessern?
- Welche Rolle spielt der demografische Wandel – besonders in Ostdeutschland?
Dabei geht es nicht um abstrakte Theorie, sondern um Ihre berufliche Realität in der Kita.
Was sich ändern muss
Der Fachkräftemangel in der Kindertagesbetreuung ist längst Alltag. Gleichzeitig werden die Anforderungen an die pädagogische Arbeit immer vielfältiger:
- mehr Dokumentation
- wachsende Bildungsansprüche
- Inklusion und kulturelle Vielfalt
- zunehmende Belastungen im Team
Viele Kolleginnen arbeiten deshalb in Teilzeit, um gesund im Beruf bleiben zu können. Doch was müsste passieren, damit sich daran etwas ändert? Welche Entlastung wäre tatsächlich wirksam?
Der Fachtag bietet Raum, genau darüber ins Gespräch zu kommen. Der Fachtag wendet sich an Erzieherinnen und Erzieher, Kita-Leitungen, Fachberatungen, Trägervertretungen, gewerkschaftliche Engagierte und Interessierte aus Politik und Wissenschaft.
Anmeldung und Organisation
📅 Datum: 1. April 2026
📍 Ort: Evangelische Hochschule Dresden
💶 Teilnahme: kostenfrei
Der Fachtag wird in Kooperation mit der Evangelischen Akademie Sachsen organisiert.
Die Anmeldung erfolgt über die Website der Evangelischen Akademie Sachsen oder per E-Mail an: akademie@evlks.de
Hintergrund: Das Projekt BeKit
Der Fachtag ist Teil des Forschungsprojekts BeKit – Beschäftigungspotenziale für die Kindertagesbetreuung (Laufzeit 08/2024–07/2026). Ziel ist es, Wege zu finden, um:
- Fachkräfte im Beruf zu halten
- Arbeitszeiten zu stabilisieren
- attraktive Rahmenbedingungen für die Kita-Arbeit zu schaffen
Gefördert wird das Projekt von der Hans-Böckler-Stiftung.
Jetzt anmelden und mitdiskutieren
Wenn Sie sich fragen, wie sich die Arbeitsbedingungen in Kitas realistisch verbessern lassen – dann ist dieser Fachtag eine gute Gelegenheit, Ihre Erfahrungen einzubringen und neue Perspektiven kennenzulernen.
Die Teilnahme ist kostenfrei.