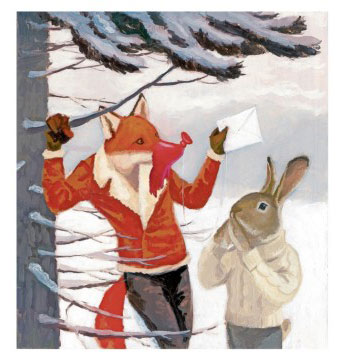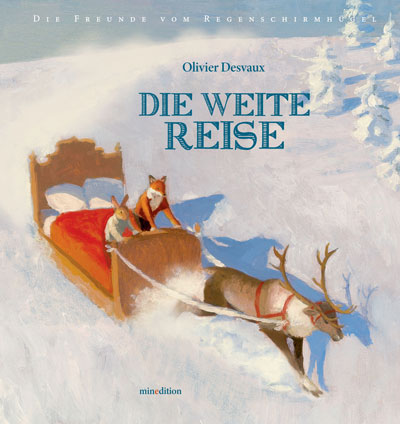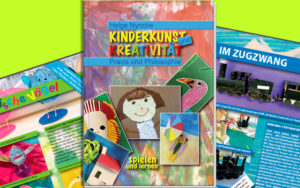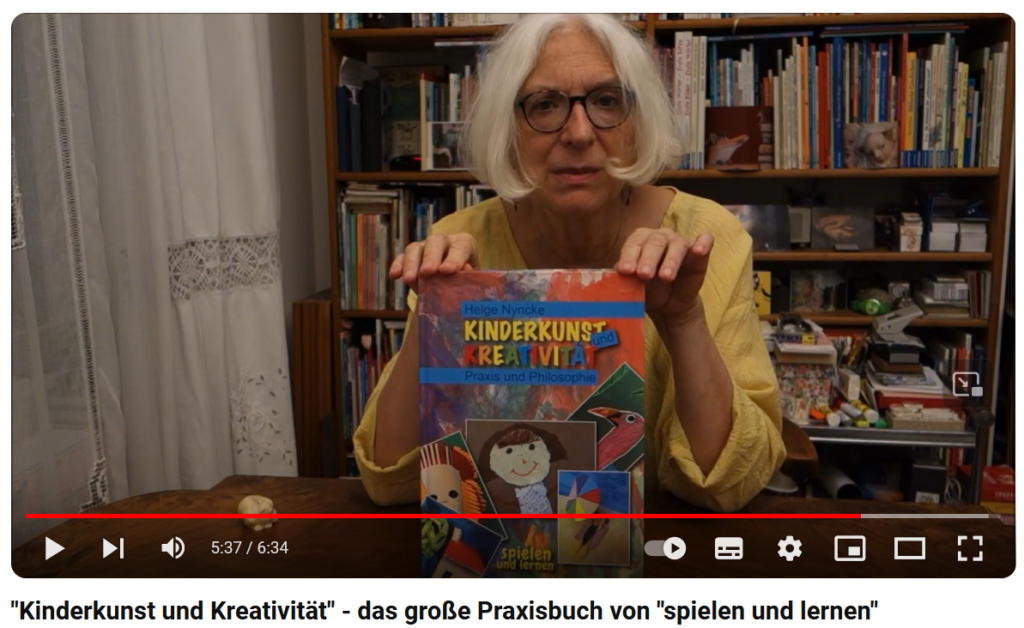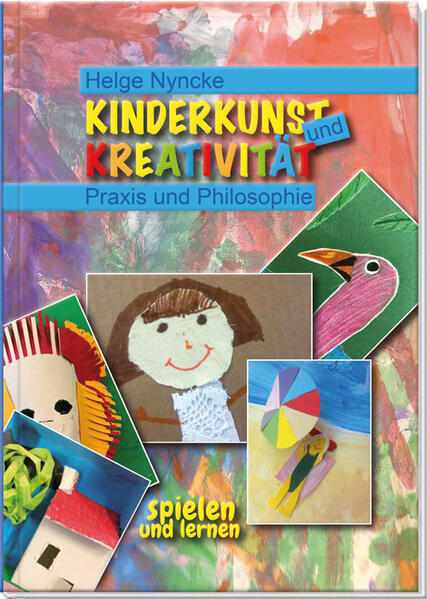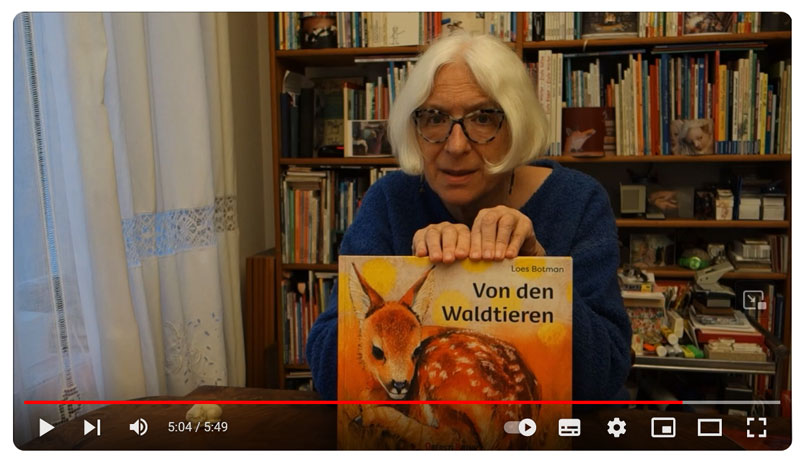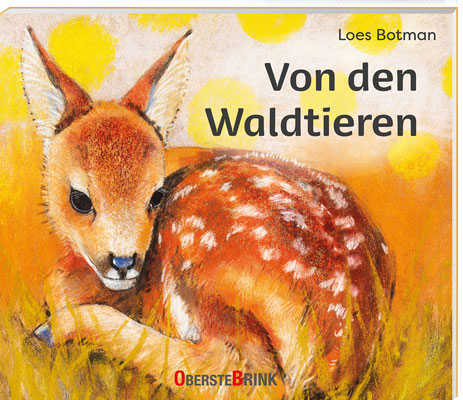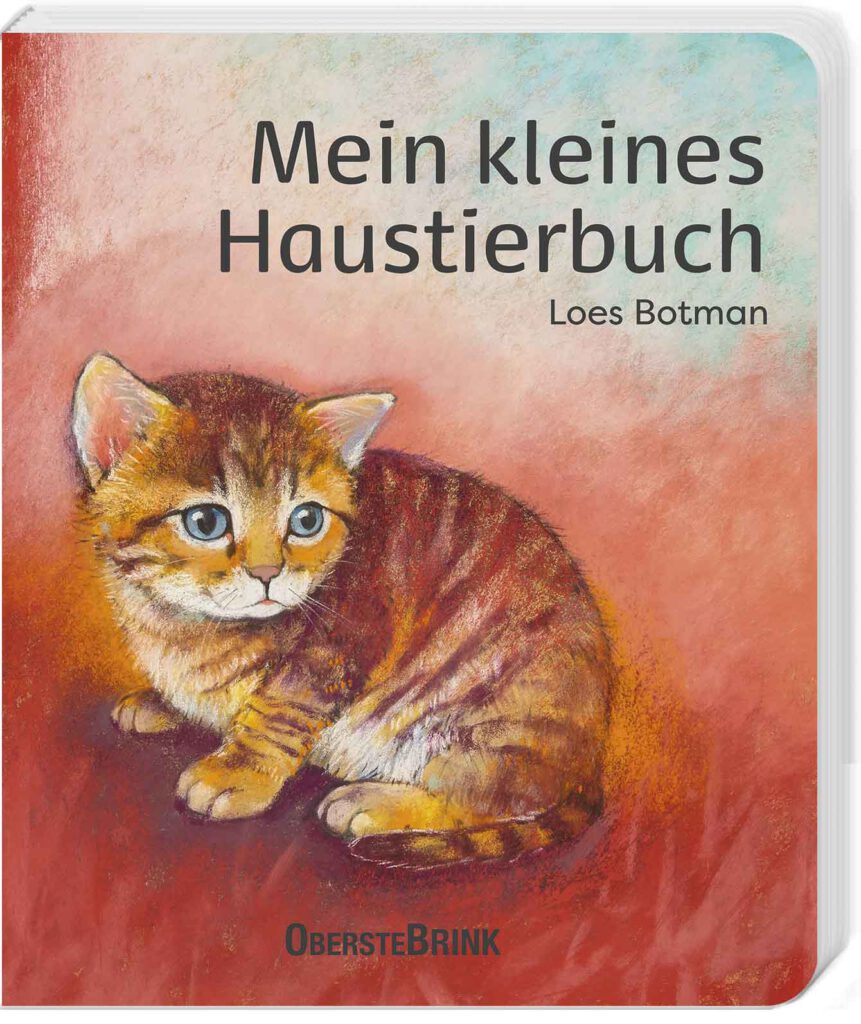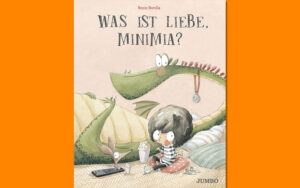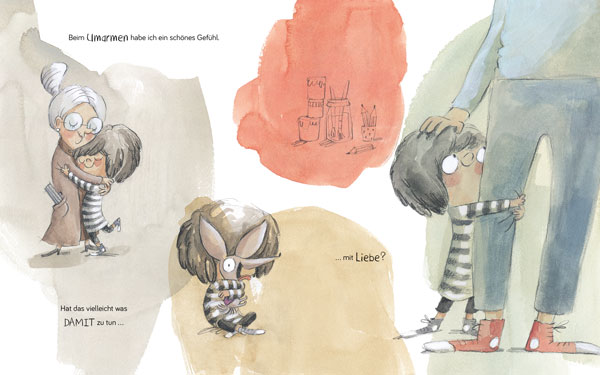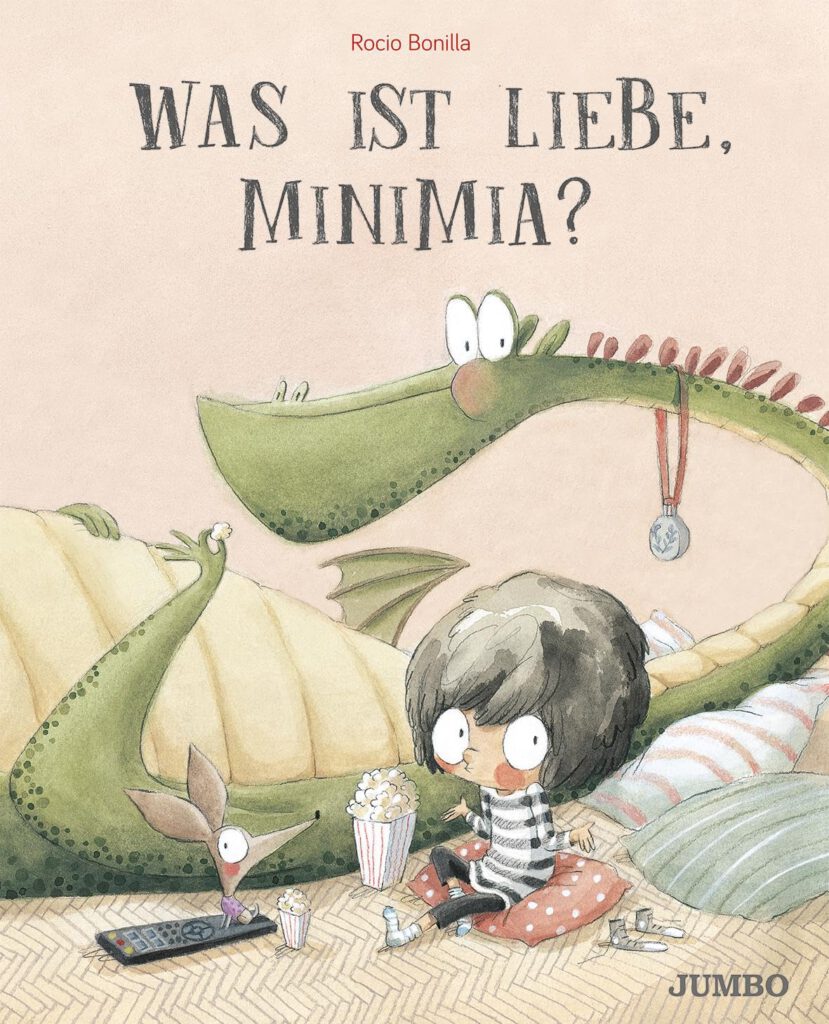Weniger Konsum, Erwartungen und Hast sorgen laut Studie für mehr Entspannung
Zwei Jahre Pandemie gefolgt von zwei Jahren Krieg und Inflation könnten Weihnachten nachhaltig verändern. Haben sich die Deutschen mit weniger Geld und dem Bruch jahrelanger Traditionen abgefunden? Teils-Teils, so das Ergebnis der jährlichen Weihnachtsstudie der Universität der Bundeswehr München – mit Optimismus für das Fest! Die Studie gibt zudem Einblicke in die Rolle von KI, Kirchen, Nachhaltigkeit, Geschlecherklischees und Stressfaktoren.
Knapp ein Drittel der Befragten (31%) ist der Meinung, dass sich Weihnachten durch die Krisen nachhaltig verändert hat. Diese Personen planen, weniger Geld für Geschenke auszugeben (58%), freuen sich weniger auf das Fest (20%; zum Vergleich: 50% freuen sich mehr) und haben geringere Erwartungen (51%; zum Vergleich: 3% haben höhere Erwartungen).
„Das mag auf den ersten Blick negativ klingen“, sagt Prof. Dr. Philipp A. Rauschnabel von der Universität der Bundeswehr München, der die Studie durchgeführt hat. „Auf den zweiten Blick sieht es aber richtig gut aus – denn: Vieles entwickelt sich zum Positiven, gerade wenn die Erwartungen niedrig sind!“. So zeigt die Studie beispielsweise, dass sich rund die Hälfte der Menschen im „New Normal“ mehr Zeit für sich und ihre Liebsten nehmen. Sie haben weniger Verpflichtungen (38%) und gehen die Feiertage gelassener und entspannter an: „Diese Personengruppe hat Weihnachten ein Stück weit entmaterialisiert und entschleunigt“, so der Ökonom Rauschnabel.
Kirchenbesuche rückläufig
Auch die Kirchen dürften unter neuen Gewohnheiten leiden. Nach zwei Jahren mit eingeschränkten Kontakten planten im letzten Jahr noch 15% einen Kirchgang. In diesem Jahr fragten die Studienautoren, ob sie im vergangenen Jahr einen Weihnachtsgottesdienst besucht hätten; auch hier lag der Wert bei 15%. „Das deutet darauf hin, dass die Entscheidung für viele Menschen bereits Anfang Dezember getroffen wird“, so Rauschnabel. In diesem Jahr planen 14% der Befragten einen Kirchenbesuch. Zum Vergleich: 2019, vor der Pandemie, waren es noch 24%. Der Rückgang dürfte also nachhaltig sein. Wer geht also dieses Jahr noch zu Weihnachten in die Kirche? „Vor allem die jungen Leute“, sagt Rauschnabel. Fast jeder Fünfte von ihnen. „Und Menschen mit einem Grundoptimismus“.
Herausforderungen für den Handel
Im Gegensatz zum vergangenen Jahr hat sich die finanzielle Situation für einige etwas entspannt. Dennoch hat der noch junge Black Friday Trend Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft. 12% haben bereits Black Friday Angebote genutzt, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. 7% haben Dinge gekauft, die sonst auf ihrem Wunschzettel gestanden hätten. 30% der Befragten gaben an, diese Rabattaktionen auch unabhängig von Weihnachten zu nutzen. 59% der Befragten mieden den Black Friday.
Rund 7% der Befragten gaben an, schon einmal Artikel bestellt zu haben, um sie nach Gebrauch wieder zurückzugeben. Bei Weihnachtsartikeln liegt der Wert mit unter 3% deutlich niedriger. „In Summe ist das dennoch eine große Belastung für die Händler, die Umwelt – und für die Menschen selbst“, so der Wirtschaftswissenschaftler. Die Abwicklung einer Retoure kostet die Menschen ordentlich Zeit – Schätzungen gehen von rund 20 Minuten pro Retoure aus. Zeit, die man in der Vorweihnachtszeit sicher sinnvoller nutzen könnte!
Künstliche Intelligenz, Digital Detox und Nachhaltigkeit
12% geben an, dass sie generell nicht auf Nachhaltigkeit achten, weitere 12%, dass sie zwar generell darauf achten, aber nicht zu Weihnachten. 19% haben sich noch keine Gedanken darüber gemacht, welche Rolle Nachhaltigkeit für sie zu Weihnachten spielt. Immerhin 32% der Befragten planen, auf unnötiges Geschenkpapier zu verzichten, dicht gefolgt vom Verzicht auf unnötige Dekoration (30%) und Reisen (26%). Auf weniger nachhaltige Lebensmittel verzichten nur 8%. Auch die bewusste Wahl nachhaltiger Einkaufsstätten (7%) ist nicht besonders beliebt.
Mehr als jeder Vierte (28%) will die Zeit, die er mit Smartphone, Tablet & Co. verbringt, reduzieren. Rund zwei Drittel (65%) werden sie weiterhin wie gewohnt nutzen, nur 7% intensiver. In der Vorweihnachtszeit könnten ChatGPT & Co allerdings für Zeitersparnis sorgen. Rund 2% räumen KI-Tools einen festen Platz in der Weihnachtsplanung ein – KI kann beispielsweise Grußkarten oder Gedichte schreiben. 21% können sich gut vorstellen, die Hilfe von KI in Anspruch zu nehmen. Rund 60% lehnen KI (eher) ab. „In den kommenden Jahren dürfte sich dieser Wert ändern“, prognostiziert der Ökonom Rauschnabel.
Konflikte vermeiden: Geschlechter- und Generationenunterschiede verstehen
Typische Streitthemen an Weihnachten sind häufig auf die unterschiedlichen Erwartungen von Männern und Frauen bzw. Jungen und Alten zurückzuführen. So empfindet mehr als ein Viertel aller Frauen (27%) Weihnachten generell als sehr stressig, bei den Männern sind es nur 20%. Sie sorgen sich dagegen um zu hohe Kosten. Menschen zwischen 30 und Anfang 40 empfinden Weihnachten generell am stressigsten. Kein Wunder – für viele von ihnen steht das erste Weihnachtsfest mit Kindern an. Passende Geschenke zu finden, ist dagegen für die jüngere Generation unter 30 das Stressthema Nummer 1.
Hintergrund zur Studie
Seit 2018 führt Prof. Dr. Philipp Rauschnabel von der Universität der Bundeswehr München die Weihnachtsstudie mit seinem Team durch. Wie in den letzten Jahren wurden wieder über 1200 Probanden über ein professionelles Online Access Panel befragt, repräsentativ quotiert nach Alter, Geschlecht und Herkunft. Feldzeit: 30.11-04.12.2023, Stichprobe: N = 1.206.
Download der Studie
Unter dem folgenden Link wird jeweils die aktuellste Version der Studie bereitgestellt. https://www.philipprauschnabel.com/blog/studie-weihnachten-2023/