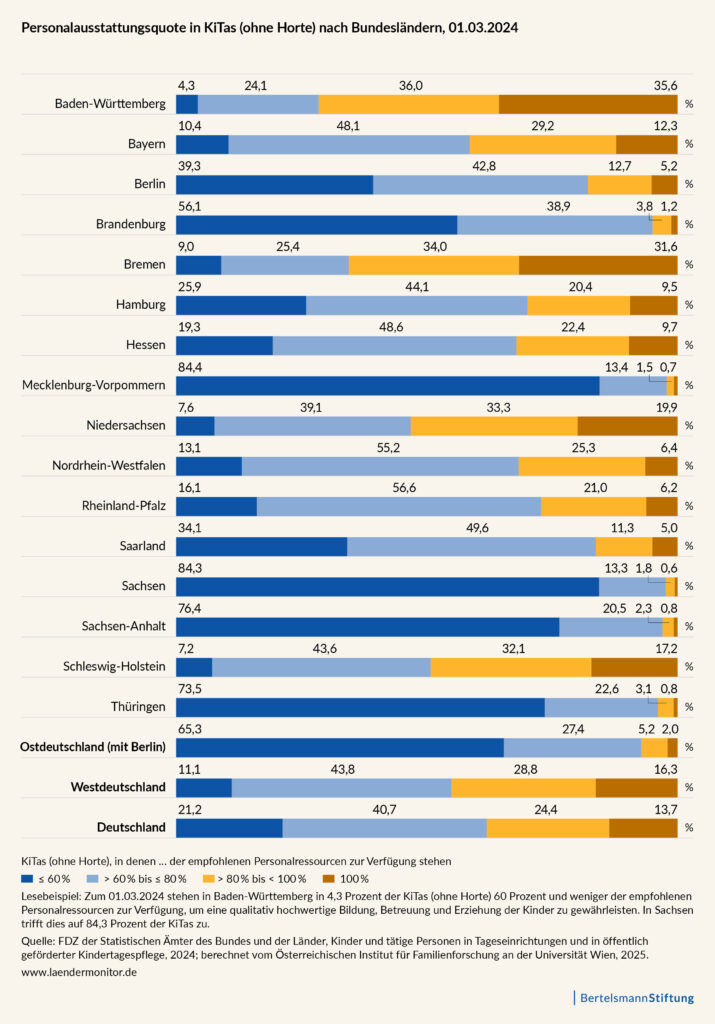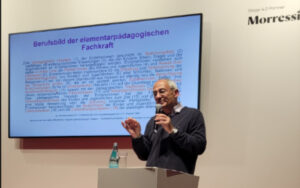Früher Kita-Besuch stärkt Wortschatz mehrsprachiger Kinder

NEPS-Studie zeigt deutliche Vorteile für Deutschkompetenzen bis zum siebten Lebensjahr
Ein früher Besuch der Kita kann für mehrsprachig aufwachsende Kinder einen entscheidenden Unterschied machen – insbesondere für ihren deutschen Wortschatz. Das zeigen aktuelle Auswertungen des Nationales Bildungspanel (NEPS). Demnach profitieren Kinder, in deren Familien überwiegend eine andere Sprache als Deutsch gesprochen wird, deutlich von einem Kita-Start vor dem zweiten Geburtstag. Bis zum Alter von sieben Jahren erzielen sie signifikant bessere Ergebnisse in Wortschatztests als Kinder mit späterem Eintritt in die frühkindliche Bildung.
Die Analyse basiert auf Daten der größten Langzeit-Bildungsstudie Deutschlands und wurde im Rahmen eines sogenannten NEPS-Schlaglichts veröffentlicht. Die zugrundeliegende wissenschaftliche Publikation erschien in der Fachzeitschrift Applied Developmental Science. Die Forschenden nutzten eine aufwändige statistische Methode (Propensity-Score-Analyse), um vergleichbare Gruppen zu untersuchen und möglichst belastbare Aussagen über die Effekte des frühen Kita-Besuchs zu treffen.
Fast zehn Aufgaben mehr im Wortschatztest
Das Ergebnis ist eindeutig: Mehrsprachige Kinder, die bereits als Kleinkinder – also vor ihrem zweiten Geburtstag – eine Kindertageseinrichtung besuchten, lösten im Alter von sieben Jahren im Wortschatztest im Schnitt fast zehn Aufgaben mehr als Kinder mit späterem Kita-Start. Dieser Unterschied ist bildungsrelevant, da Wortschatz als zentrale Grundlage für schulischen Erfolg gilt. Ein gut entwickelter deutscher Wortschatz erleichtert nicht nur das Lesen und Schreiben, sondern wirkt sich auch positiv auf die Leistungen in anderen Fächern aus.
Für Kinder aus ausschließlich deutschsprachigen Familien zeigte sich hingegen kein vergleichbarer Effekt. Das bedeutet: Der frühe Kita-Besuch ist besonders für jene Kinder bedeutsam, die Deutsch nicht als Familiensprache erleben und deshalb außerhalb des Elternhauses auf sprachliche Anregung angewiesen sind.
Frühkindliche Bildung als Schlüssel zur Integration
Die Ergebnisse unterstreichen die wichtige Rolle frühkindlicher Bildung für Chancengerechtigkeit und Integration. In der Kita kommen Kinder regelmäßig mit der deutschen Sprache in Kontakt – im Spiel, in Gesprächen mit pädagogischen Fachkräften und im Austausch mit Gleichaltrigen. Diese alltagsintegrierte Sprachförderung scheint langfristig positive Effekte zu haben.
Gerade in Familien, in denen eine andere Muttersprache gesprochen wird, eröffnet ein früher Kita-Besuch zusätzliche Lerngelegenheiten. Kinder können ihren deutschen Wortschatz systematisch erweitern, noch bevor sie eingeschult werden. Damit verbessern sich ihre Startbedingungen für die Grundschule deutlich.
NEPS-Schlaglichter: Forschung verständlich aufbereitet
Die Ergebnisse wurden im Rahmen der NEPS-Schlaglichter veröffentlicht. Dieses Format bereitet ausgewählte Befunde aus dem Nationalen Bildungspanel kompakt und verständlich auf. Jedes Schlaglicht fasst eine zentrale Erkenntnis zusammen, erläutert die Hintergründe und stellt die Daten anschaulich dar. Ziel ist es, wissenschaftliche Ergebnisse für Politik, Praxis und Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Herausgegeben werden die NEPS-Schlaglichter vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi), das das Nationale Bildungspanel verantwortet. Die Studie begleitet seit vielen Jahren Bildungsprozesse von der frühen Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Mehr als 70.000 Teilnehmende wurden bislang wiederholt befragt, die Daten stehen der internationalen Forschung zur Verfügung.
Klare Botschaft für Bildungspolitik und Praxis
Die aktuellen Befunde liefern eine klare Botschaft: Ein früher Kita-Besuch kann die Sprachentwicklung mehrsprachiger Kinder nachhaltig stärken. Insbesondere der deutsche Wortschatz profitiert deutlich, wenn Kinder bereits im Kleinkindalter institutionelle Bildungsangebote nutzen.
Für Eltern, Träger und Bildungspolitik bedeutet das: Frühzeitige Zugänge zu qualitativ hochwertiger frühkindlicher Bildung sind ein wichtiger Baustein für mehr Bildungsgerechtigkeit. Wer Sprachförderung ernst nimmt, sollte deshalb den frühen Kita-Besuch – insbesondere für mehrsprachig aufwachsende Kinder – gezielt unterstützen.
Originalpublikation:
Willard, J. A., Burghardt, L., Kohl, K., & Anders, Y. (2026). Does entering early childhood education as a toddler benefit language and social development until age seven? A propensity score analysis. Applied Developmental Science, 30(1), 88–111. https://doi.org/10.1080/10888691.2024.2382122
Gernot Körner