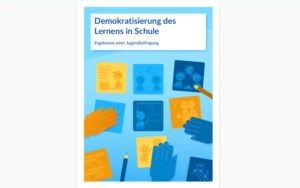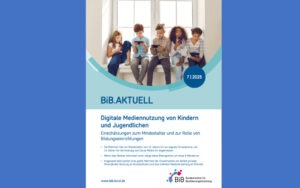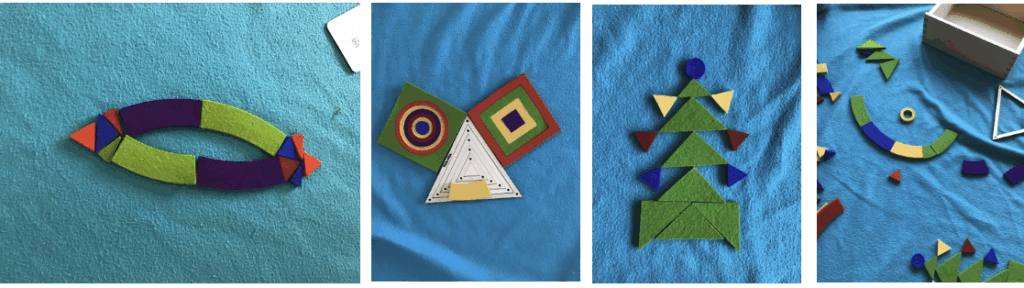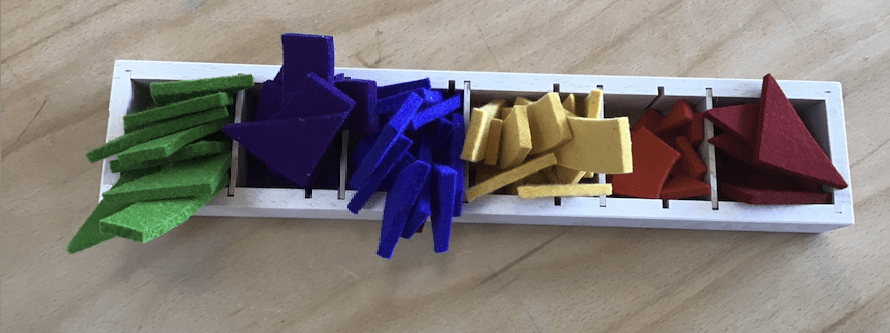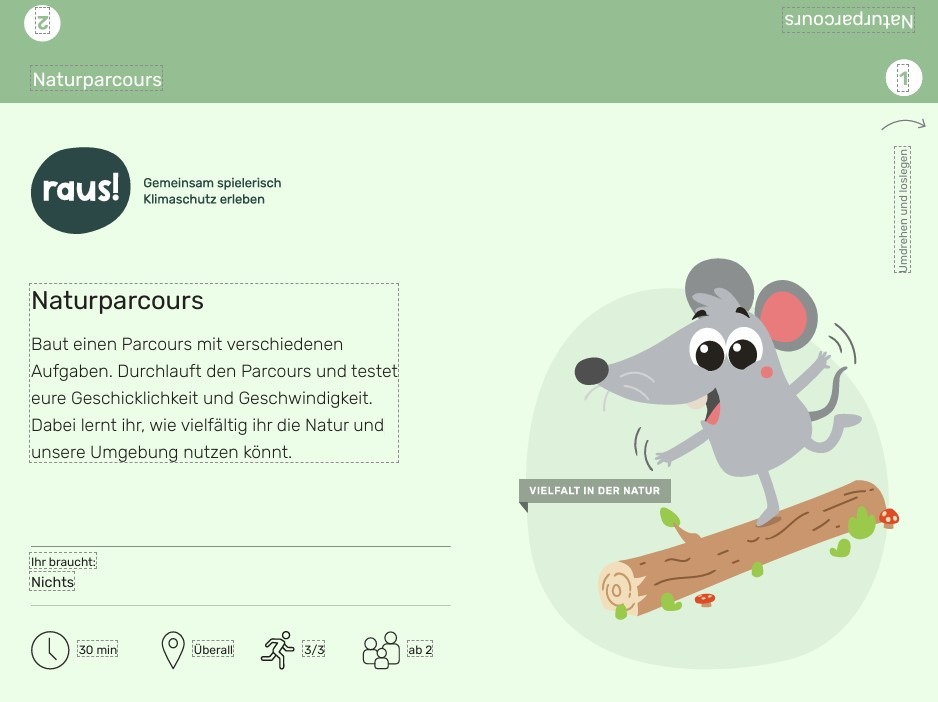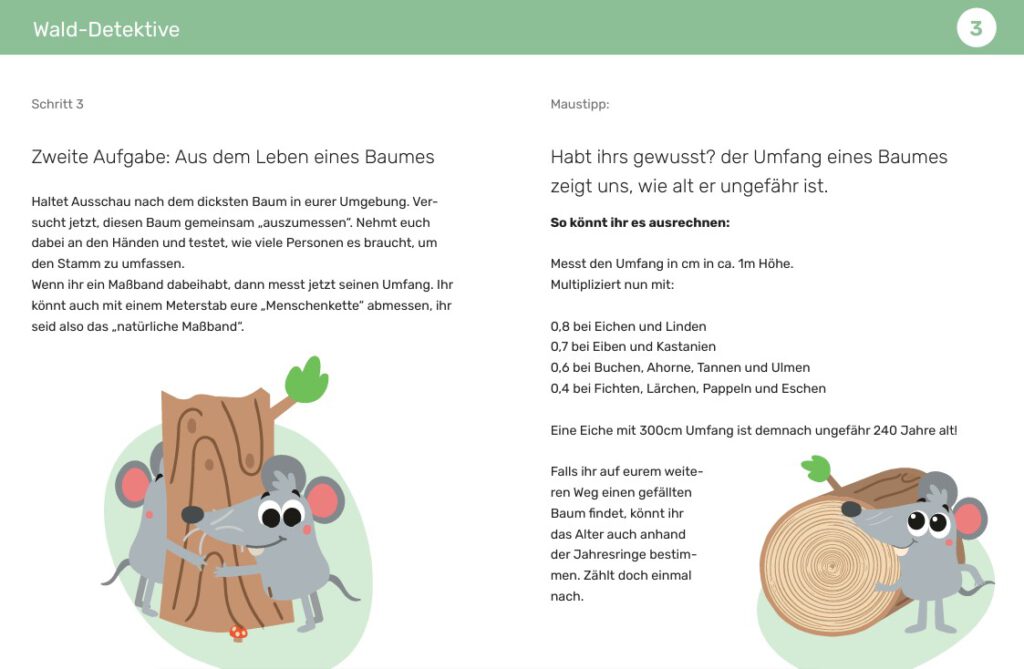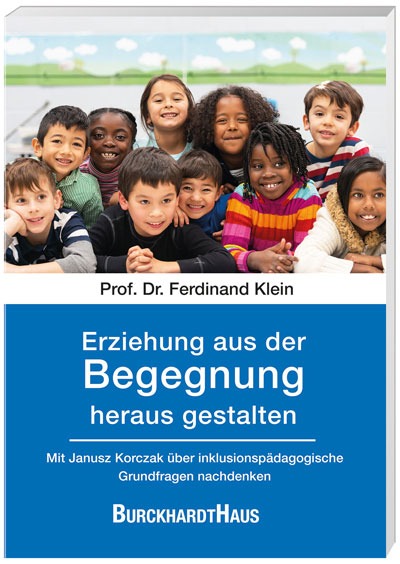KinderVan W6 von WonderFold: 6-Sitzer für den Kita-Alltag

Stabil, komfortabel und mit großem Stauraum – so bewährte sich der Kinderwagen im Würzburger Praxistest
In Kindertagesstätten gehört es zum Alltag, mehrere Kinder gleichzeitig sicher und komfortabel zu transportieren. Für diesen Zweck gibt es spezielle Mehrsitzer-Kinderwagen, die den Anforderungen von Erzieherinnen und Erziehern gerecht werden. Einer der neuesten Vertreter ist der WonderFold W6 KinderVan, ein moderner 6-Sitzer-Kinder- und Transportwagen mit viel Stauraum, stabiler Bauweise und cleveren Sicherheitsfeatures.
Wir haben den WonderFold W6 vier Wochen lang in einer Würzburger Kita getestet und dabei geprüft, wie er sich im täglichen Einsatz mit den Kindern bewährt.

Viel Platz für Kinder – und für alles, was dazugehört
Der WonderFold W6 bietet Platz für bis zu sechs Kinder. Die Sitze sind herausnehmbar, weich gepolstert und mit 5-Punkt-Sicherheitsgurten ausgestattet. Besonders im Vergleich zu herkömmlichen Modellen fiel auf, dass die Kinder bequemer sitzen und auch längere Fahrten entspannt meistern. Eine Erzieherin aus der Kita Würzburg berichtete nach einer Fahrt: „Die Kinder hatten richtig Spaß und saßen entspannt im Wagen. Niemand hat gemeckert, das spricht schon für den Komfort.“ Auch ist der Wagen etwas schmaler als andere, was ein leichtes Durchkommen – vor allem durch Türen – ermöglicht.
Der tiefe Innenraum und die erhöhte Sitzposition ermöglichen es den Kindern, nach draußen zu schauen – ein entscheidender Pluspunkt für neugierige Kita-Kinder, die ihre Umwelt aktiv wahrnehmen möchten.
Handhabung im Alltag: leichtgängig mit kleinen Einschränkungen
Im täglichen Einsatz wurde der W6 mehrere Male pro Woche genutzt, etwa für Spaziergänge, Ausflüge oder Wege über das Kitagelände. Insgesamt ließ sich der Wagen gut fahren. Geradeaus war das Schieben angenehm und kraftsparend, bei Kurven musste jedoch etwas mehr gesteuert werden.
Ein pädagogischer Mitarbeiter fasste es so zusammen: „Wenn es geradeaus geht, fährt er super. Bei Kurven merkt man, dass die Räder unterschiedlich arbeiten. Zieht man den Wagen, wird es leichter – beim Schieben ist der Wendekreis recht groß.“
Das gilt vor allem dann, wenn der Wagen mit sechs Kindern und dem üblichen Gepäck für Ausflüge voll besetzt ist. Bei geringerer Zuladung ist eben alles leichter.
Besonders hilfreich sind die beiden Griffe, die es ermöglichen, den Wagen nicht nur zu schieben, sondern auch flexibel zu ziehen. Damit eignet sich der KinderVan auch für längere Ausflüge oder wenn das Gelände uneben ist.

Sicherheit und Schutz: Stabilität überzeugt
Ein entscheidendes Kriterium im Kita-Alltag ist die Sicherheit. Hier zeigte sich der WonderFold W6 zuverlässig. Der Wagen steht stabil – selbst dann, wenn Kinder sich daran hochziehen oder abstützen. In einem Testversuch kletterten Kinder am Rahmen, ohne dass der Wagen ins Wanken geriet.
Das große Sonnendach sorgt für wirksamen Schutz vor starker Sonneneinstrahlung und Wind. Pädagogische Fachkräfte lobten die Lösung: „Das Dach ist super. Gerade bei Ausflügen im Sommer ist es wichtig, dass die Kinder nicht nur durch eine Mütze geschützt sind.“
Einziger Kritikpunkt war die Handhabung der Gurte, die in der Praxis etwas umständlich wirken. Hier wäre ein vereinfachtes System wünschenswert, damit Kinder schneller und stressfreier angeschnallt werden können. Andererseits sitzen die Kinder, nachdem sie mit den Fünfpunktguten angeschnallt wurden, supersicher.
Fahrkomfort auf unterschiedlichen Untergründen
Im Test fuhr der KinderVan nicht nur auf Asphalt, sondern auch über Kopfsteinpflaster, Schotterwege und sogar über Gartenschläuche. Das Ergebnis: Die Federung und die XL-Räder machten kleine Hindernisse problemlos mit.
Eine Erzieherin erklärte: „Wir sind auch über Kopfsteinpflaster gefahren – das war kein Problem. Der Wagen ist robust und federt Unebenheiten gut ab.“
Für steilere Strecken im vollbeladenen Zustand wäre eine zusätzliche Handbremse sinnvoll. Hier bietet der Hersteller mittlerweile eine Lösung an: sogenannte E-Wheels (elektrische Räder), die nicht nur beim Schieben unterstützen, sondern auch aktives Bremsen ermöglichen. Diese Option macht den W6 besonders interessant für Kitas, die Ausflüge in hügeliges oder unwegsames Gelände planen.
Praktische Details: Stauraum und Klappfunktion
Neben den Sitzen überzeugt der W6 auch durch durchdachte Extras. Ein großzügiger Stauraum mit Taschen und ein abnehmbarer Korb mit Kühlfach sorgen dafür, dass Snacks, Getränke und Wechselkleidung problemlos Platz finden. Für den Kita-Alltag, in dem viel Material mitgenommen werden muss, ist das ein großer Vorteil.
Außerdem lässt sich der Wagen mit wenigen Handgriffen zusammenklappen und erstaunlich platzsparend verstauen. Im Gegensatz zu vielen sperrigen Konkurrenzmodellen passt er so auch in kleinere Lagerräume oder Fahrzeuge.
Pro & Contra auf einen Blick
Vorteile:
- Platz für bis zu sechs Kinder
- Bequeme, gepolsterte Sitze
- Sehr guter Sonnenschutz
- Hohe Stabilität, auch bei Bewegung der Kinder
- Viel Stauraum und praktisches Kühlfach
- Klappbar und leicht zu verstauen
- Geländegängig
- Hoher Fahrkomfort auch auf unebenen Untergrund
- Schmaler als andere, kommt deshalb durch Türen
Verbesserungspotenzial:
- Wendekreis in Kurven relativ groß
- Gurt-System etwas umständlich
- Handbremse nur als Zubehör (E-Wheels) erhältlich

Fazit: Ein moderner Kinderwagen für den professionellen Einsatz
Der WonderFold W6 KinderVan hat sich im Würzburger Praxistest als stabiler, komfortabler und zuverlässiger 6-Sitzer Kinderwagen für Kitas erwiesen. Die Kinder fuhren sicher, bequem und mit sichtbarer Freude. Pädagogische Fachkräfte schätzten die hohe Stabilität, den Sonnenschutz und die gute Federung.
Kleinere Kritikpunkte wie das Gurt-System oder der Wendekreis schmälern den positiven Gesamteindruck kaum – zumal der Hersteller mit den optionalen E-Wheels bereits Lösungen anbietet. Damit ist der WonderFold W6 eine intelligente und moderne Transportlösung für Kindertagesstätten, die regelmäßig mit mehreren Kindern unterwegs sind und Wert auf Sicherheit, Komfort und Praxistauglichkeit legen.
Weitere Informationen finden Sie hier…
Gernot Körner