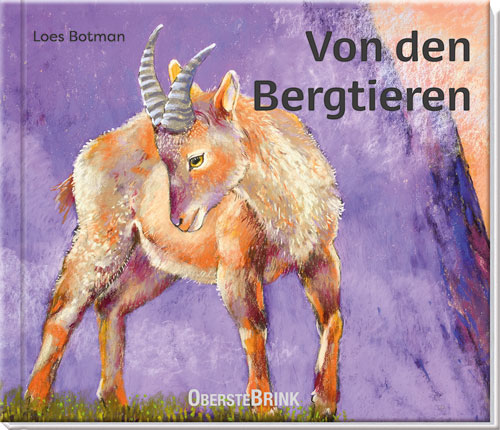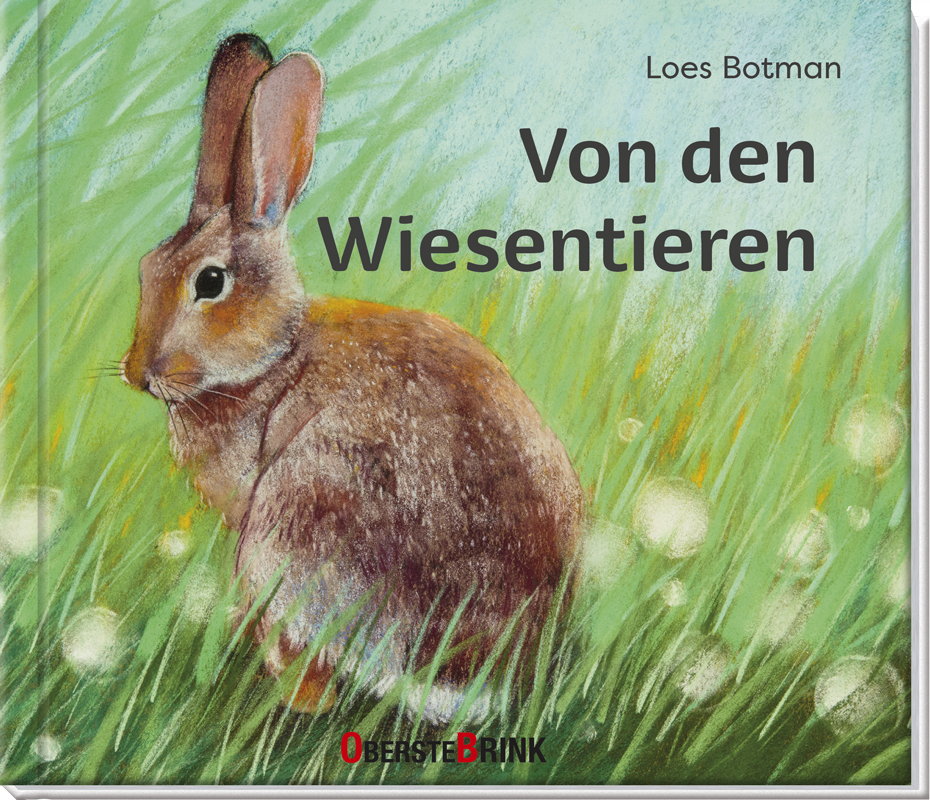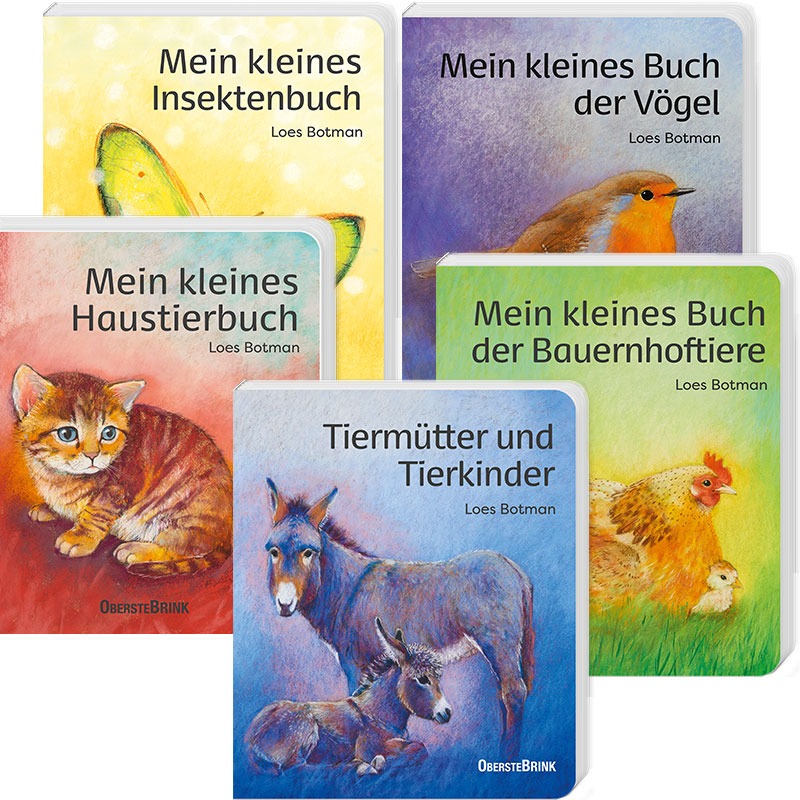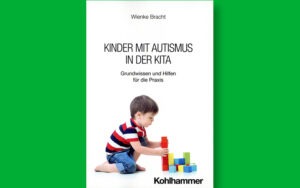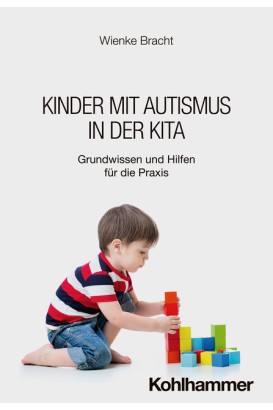Die Weihnachtsgeschichte für Kinder erzählt

Die Geschichte von der Geburt von Jesus in Anlehnung an die Bibel erzählt
Die Geschichte von der Geburt Jesu Christi Kindern zu erzählen, ist gar nicht einfach. Da ist von fremden Ländern die Rede, von Engeln, einem Kaiser sowie von Schwangerschaft und Geburt. Schließlich ist vieles auch in einer altertümlichen Sprache verfasst. Und wer ist eigentlich Jesus?
Kinder haben jedoch ein großes Interesse daran zu erfahren, was an Weihnachten gefeiert wird. Die untenstehende Geschichte soll Ihnen helfen, die Weihnachtsgeschichte den Kindern näherzubringen. Sie können sie einfach vorlesen oder beim Lesen in Ihre eigenen Worte kleiden. Die Kinder werden bestimmt viele Fragen haben und dabei auch manches über sich selbst entdecken.
Die Weihnachtsgeschichte
Dies ist die Geschichte von der Geburt Jesu Christi (das heißt: der Gesalbte), der nach christlicher Lehre von Gott ausgesandt wurde, um die Menschen von allem Bösen zu erlösen:
Vor langer, langer Zeit, vor über 2000 Jahren, als die meisten Menschen noch in Hütten wohnten und sich meist zu Fuß fortbewegten, entschloss sich der römische Kaiser, sein Volk zählen zu lassen. Wie ihr vielleicht wisst, liegt Rom in Italien. Das Reich des Kaisers war damals jedoch sehr groß. Deshalb mussten sich auch die Menschen in weit entfernten Ländern zählen lassen. Zu ihnen gehörten auch Maria und Josef.
Josef stammte aus Bethlehem in Judäa. Dieser Ort liegt im heutigen Israel, nicht weit vom Mittelmeer entfernt. Er und seine Frau lebten zu dieser Zeit jedoch weit im Norden, in Nazareth in Galiläa. Weil alle Menschen in ihren Geburtsort gehen mussten, um sich zählen zu lassen, machten sich auch Maria und Josef auf die lange Reise. Nazareth ist von Bethlehem über 120 Kilometer entfernt. Außerdem war Maria schwanger, und ihr Kind sollte bald zur Welt kommen.
Viele Menschen waren unterwegs und suchten in Bethlehem eine Unterkunft. Als Maria und Josef dort ankamen, fanden sie keinen Platz mehr für sich. Beide waren sehr müde, und Maria spürte, dass ihr Kind bald geboren werden würde. So beschlossen sie, in einer leer stehenden Hütte oder einer Höhle Schutz zu suchen. Dort brachte Maria ihren Sohn zur Welt. Sie nannten ihn Jesus. Der Name bedeutet: „Der Herr rettet.“ Maria wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil sie kein Bettchen für ihn hatten.
In der Nähe hüteten Hirten ihre Schafe auf einem Feld. Da trat ein Engel zu ihnen. Er leuchtete hell, und die Hirten fürchteten sich sehr.
Doch der Engel sprach zu ihnen:
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und dies habt zum Zeichen: Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend.“
Nachdem er dies gesagt hatte, erschienen viele Engel. Sie lobten Gott und sprachen:
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.“
Als die Engel wieder verschwunden waren, sagten die Hirten zueinander:
„Lasst uns nach Bethlehem gehen und sehen, was dort geschehen ist.“
Sie machten sich auf den Weg, fanden Maria und Josef und dazu das Kind, das in der Krippe lag. Als sie alles gesehen und gehört hatten, erzählten sie davon weiter. Viele Menschen wunderten sich darüber. Maria aber dachte lange über all das nach und bewahrte die Worte in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten schließlich zu ihren Schafen zurück und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten.