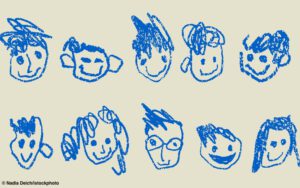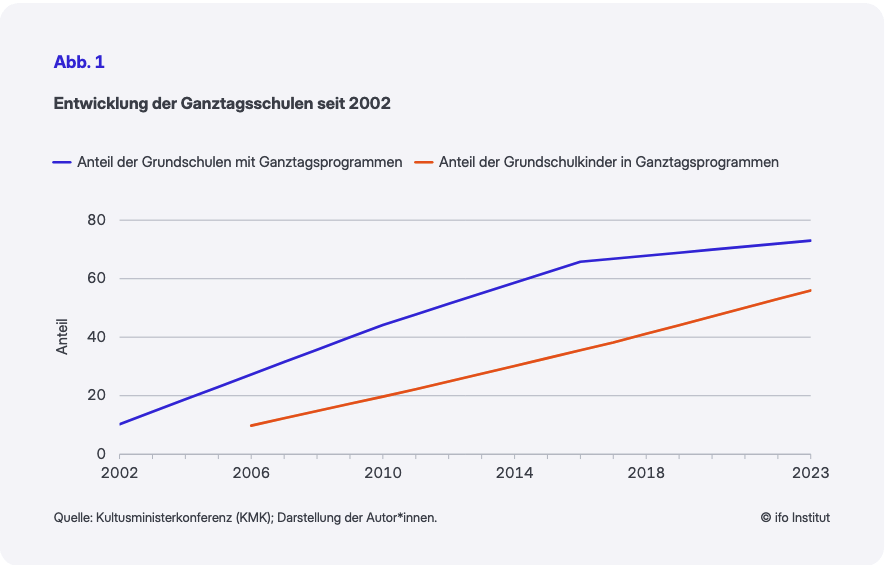Frühkindliche Bildung legt den Grundstein für Integration, Teilhabe und faire Chancen – besonders für Kinder aus zugewanderten oder einkommensschwachen Familien
In Deutschland hängt der Bildungserfolg weiterhin stark von der sozialen Herkunft ab. Kinder aus einkommensschwachen Familien haben geringere Chancen, ihr Potenzial zu entfalten – besonders, wenn sie oder ihre Eltern zugewandert sind. Der Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) zeigt in seinem aktuellen Positionspapier „Bildung als Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe“, wie sich das ändern kann.
Viele Kinder mit Migrationshintergrund leben in finanziell benachteiligten Familien und sprechen zu Hause nicht Deutsch. Für sie ist eine frühe Förderung in der Kita entscheidend, betont Bildungsforscherin Prof. Birgit Leyendecker, Mitglied im SVR: „Das Fundament für einen erfolgreichen Bildungsweg wird bereits in der Kita gelegt.“
Frühkindliche Förderung: Der Schlüssel zu Chancengleichheit
Obwohl alle Kinder ab dem ersten Geburtstag einen Anspruch auf einen Kita-Platz haben, nehmen zugewanderte Familien dieses Recht seltener wahr. Die Gründe sind vielfältig: mangelnde Kenntnisse des deutschen Bildungssystems, Angst vor Diskriminierung, fehlende kultursensible Betreuung oder auch finanzielle Hürden.
Dabei profitieren gerade diese Kinder von der frühen Sprachförderung und der sozialen Teilhabe in der Kita. Prof. Havva Engin, Expertin für interkulturelle Bildung, erklärt: „Das möglichst frühe Erlernen einer Sprache – alltagsintegriert in der Kita – und ein chancengerechter Zugang zu Bildung fördern Integration und erleichtern den weiteren Bildungsweg.“
Der SVR begrüßt daher die Wiederaufnahme des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“, das die durchgängige Sprachbildung von der Kita bis in die Grundschule stärken soll.
Schulen brauchen Unterstützung nach Sozialindex
Auch in der Schule sollte Förderung gezielt dort ansetzen, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Schulen in sozial herausgeforderten Lagen, an denen viele Kinder aus armutsgefährdeten oder zugewanderten Familien lernen, benötigen mehr Ressourcen. Das Startchancen-Programm von Bund und Ländern sei ein wichtiger Schritt, so der SVR.
Empfohlen wird eine sozialindexbasierte Schulfinanzierung, die Mittel gerecht verteilt. Zudem müsse der Zugang zu Bildung für geflüchtete Kinder und Jugendliche beschleunigt werden. Vorbereitungsklassen könnten den Einstieg erleichtern, sollten aber nur eine Übergangslösung sein – Ziel müsse die schnelle Integration in Regelklassen sein.
Bildungschancen auch für geflüchtete Jugendliche
Geflüchtete Jugendliche, die später in das deutsche Bildungssystem einsteigen, laufen Gefahr, ohne Schulabschluss zu bleiben. Der SVR empfiehlt daher, die Berufsschulpflicht für junge Erwachsene mit Fluchtbiografie zu verlängern. So könnten sie Deutsch lernen, ihre Kompetenzen ausbauen und sich auf eine Ausbildung vorbereiten.
„Nur wer die Sprache beherrscht und Zugang zu Bildung hat, kann beruflich und gesellschaftlich teilhaben“, betont Prof. Leyendecker. Bildung sei ein Menschenrecht – unabhängig vom Aufenthaltsstatus.
Vielfalt als Chance – nicht als Herausforderung
Die kulturelle und sprachliche Vielfalt in Kitas und Schulen ist längst Alltag. Doch noch ist wenig darüber bekannt, wie effektiv viele Maßnahmen tatsächlich sind. Der SVR fordert daher, Bildungsprogramme systematisch zu evaluieren, um Ressourcen gezielt und wirksam einzusetzen.
Dazu gehören auch Empfehlungen wie:
- Mehr Sensibilität für Diversität in der Lehrkräftebildung
- Nutzung des Potenzials zugewanderter Pädagoginnen und Pädagogen
- Hochwertige Brückenangebote bis zum Schuleintritt
- Besondere Unterstützung für geflüchtete junge Frauen
- Bessere Beratung und Begleitung im Studium
Bildung ist der Schlüssel zu Teilhabe
Frühe Förderung, faire Chancen und kulturelle Offenheit sind die Grundlage für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn alle Kinder – unabhängig von Herkunft oder Einkommen – Zugang zu guter Bildung erhalten, profitieren nicht nur sie selbst, sondern die ganze Gesellschaft.
Weitere Informationen: https://www.svr-migration.de/publikation/bildung-als-schluessel-fuer-gesellschaftliche-teilhabe/