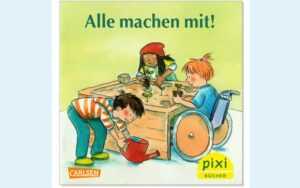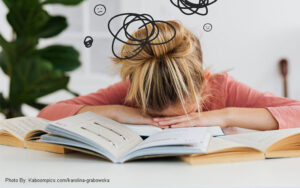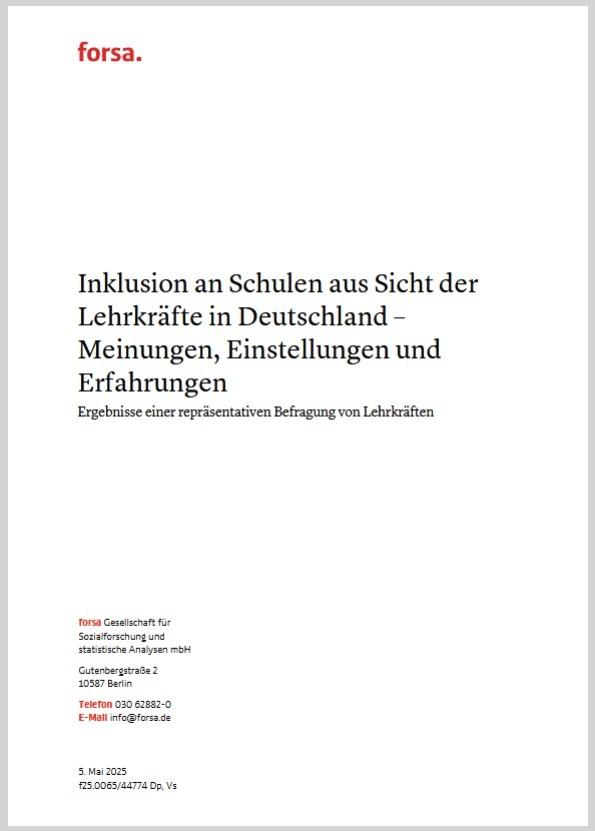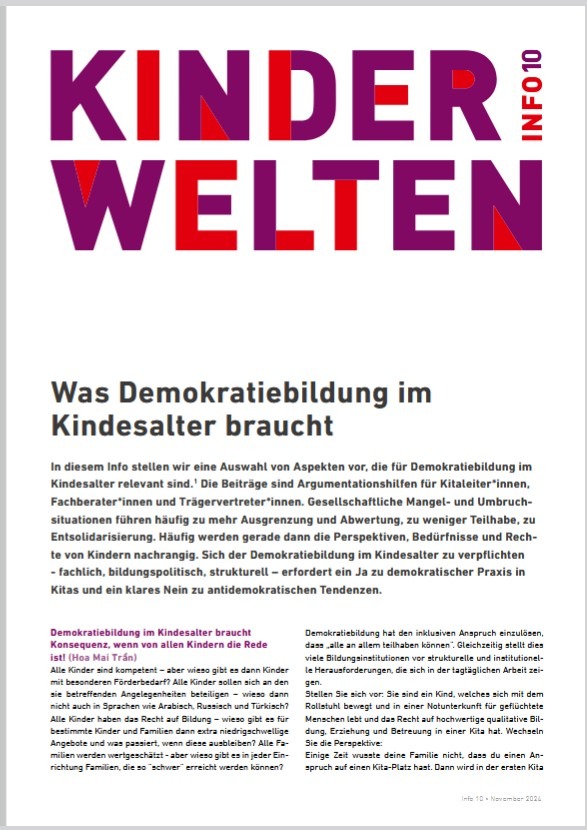Praxisnahe Impulse für Kinder mit hohem Förderbedarf

Ergotherapeutisch fundierte Anregungen für entwicklungsorientierte Förderung im pädagogischen Alltag
Dieses Buch (mit Spiralbindung) ist aus der jahrelangen praktischen Erfahrung der Autorin, die als Ergotherapeutin in der Pädiatrie tätig ist, entstanden. Es wendet sich sowohl an (heil-)pädagogische Fachkräfte in Kitas, an Mitarbeiter*innen in ergotherapeutischen Praxen als auch an Eltern und bietet eine ganze Reihe von Vorschlägen, Ideen und Beschäftigungsimpulsen für Kinder im Alter von zwei bis sieben Jahren, die einen besonders hohen Bedarf an Entwicklungsunterstützung haben.
Die allermeisten Spielgegenstände, mit denen Kinder ohne einen sehr hohen Förderbedarf hantieren und spielen, sind für Kinder mit einem besonders hohen Bedarf an Entwicklungsunterstützung in der Regel nicht brauchbar, weil sie häufig noch keine (ausreichend) basalen Handlungsmuster aufgebaut haben oder beherrschen und ihnen zusätzlich emotionale Sicherheiten fehlen, um sich auf ein intrinsisch motiviertes Erkundungs- und Spielinteresse einlassen zu können. Um die Differenz zwischen dem tatsächlich vorhandenen Lebensalter des Kindes und seinem Entwicklungsalter anzunehmen und dem Kind entwicklungsorientierte (!) Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten, durch die das Kind mit der Zeit Handlungssicherheiten auf- und ausbauen kann, werden in dem Buch vielfältige Handlungsimpulse vorgestellt.
Zunächst gibt Ursula Wilmes den Leserinnen einige Informationen zur Entwicklung der Spielfähigkeit, der Handgeschicklichkeit und Feinmotorik, des Malens und Bastelns (1) sowie der sensomotorischen Entwicklung (2), systematisch nach Lebensaltermonaten (1) bzw. den sechs Stufen (2) klassifiziert. (Anmerkung: Auch wenn sich seit ca. 20 Jahren sehr namhafte Wissenschaftlerinnen, z. B. Prof. Rolf Oerter, Prof. Leo Montada, Prof. Joan Bliss, Prof. Heidi Keller, aufgrund der völligen Vernachlässigung kultureller und sozialer Einflussfaktoren gegen diese von Piaget sehr starre Stufeneinteilung ausgesprochen haben und auch keine Literaturbelege für die Entwicklung der Spielfähigkeit – z. B. Prof. A. Jean Ayres, Prof. Hans Mogel, Prof. A. F. Zimpel – genannt wurden, können diese stichwortartigen Merkmalsnennungen für Berufseinsteiger*innen hilfreich und dienlich sein, grobe Orientierungswerte zu bekommen.) Es folgen besondere Hinweise zu Hilfen für ein Kind mit einem sehr hohen Förderbedarf, eine Ideensammlung zu Beschäftigungs-, Bewegungs- und Spielangeboten im umfangreichsten Buchteil mit 90 Seiten, und im letzten, sehr kurz gehaltenen Kapitel (zwei Seiten) geht die Autorin auf Hilfsmittel beim Essen sowie auf handelsübliche und selbst hergestellte Hilfsmittel ein.
Was rundum gefällt: Alle Ideen werden neben kurzen Beschreibungen der Erfahrungsmöglichkeiten für das Kind, des Handgeschicks und möglicher Varianten durch Fotos unterstützt, sodass Leser*innen stets eine praktische Vorstellung von den Impulsvorschlägen gewinnen können. Was sicherlich den Wert des Buches noch stärker aufgewertet hätte, wäre ein Kapitel gewesen, das sich mit der „authentischen Zuwendung zum Kind, der Mitspiel- und Entdeckungsfreude des entwicklungsbegleitenden Erwachsenen sowie den gemeinsam erlebten, emotional besetzten Kommunikations- und Interaktionserlebnissen“ befasst hätte. Auch wenn im Untertitel des Buches der Begriff „Spielmöglichkeiten“ vorkommt, ist selbst bei einem sehr sorgsamen Durchlesen des Buches von erwähnten „Spielmöglichkeiten“ nichts zu verspüren. So wirkt das Buch eher funktional strukturiert, rein förderpädagogisch orientiert und lerndidaktisch konzipiert, und an keiner Stelle ist der überaus bedeutsame Aspekt einer „Bildung durch Bindung“ zu entdecken. Gleichwohl ist es ein Fachbuch, das sich als praktischer Impulsgeber, besonders für elementarpädagogische Fachkräfte, eignet, die in ihrer inklusionsgeprägten Praxis immer wieder auf der Suche nach Praxisideen sind. Wenn dann noch alle hier dargebotenen „Übungen“ in spielerischer Weise mit Kindern durchgeführt und emotional erlebt werden, wird das Buch mit Sicherheit ein im wahrsten Sinne des Wortes „guter Ratgeber“ sein.
Prof. Dr. Armin Krenz
Bibliographie

Wilmes, Ursula: Anfassen, Hantieren, Spielen. Betätigungsideen und Spielmöglichkeiten für kleine Kinder mit sehr hohem Förderbedarf. verlag modernes lernen Borgmann GmbH & Co, Dortmund 2026. 125 Seiten, 22,95 €.
ISBN: 978-3-8080-0974-1