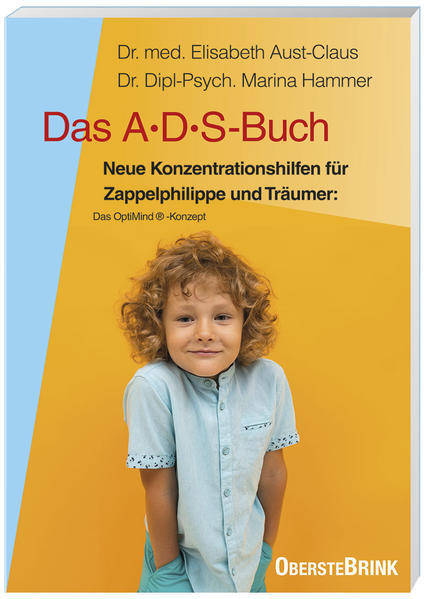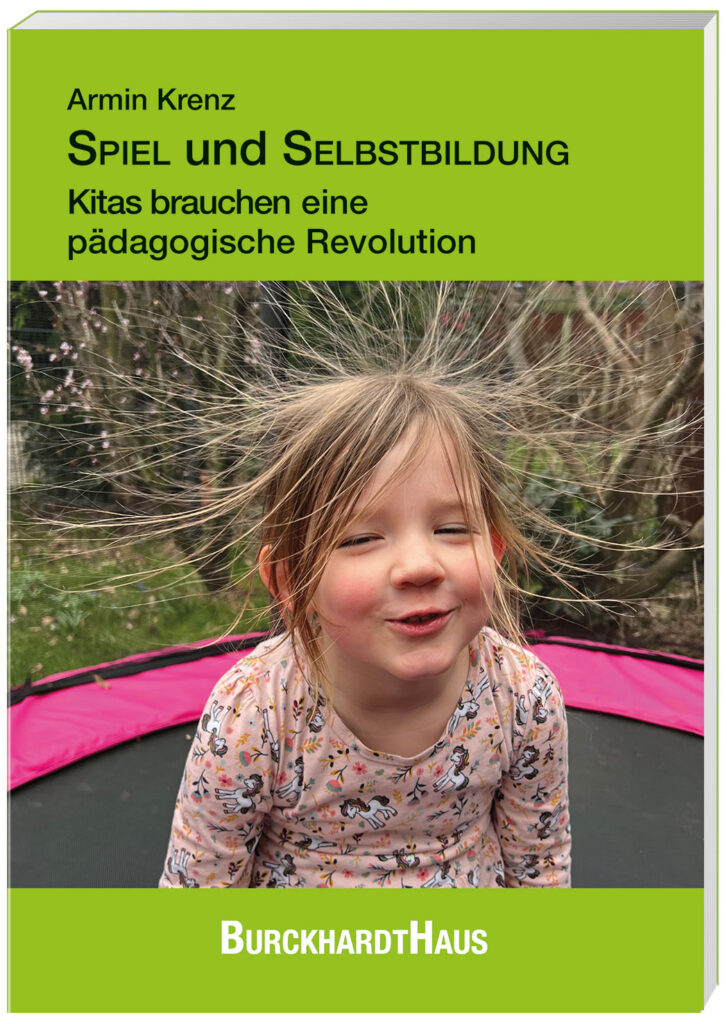Wie Vorstellungskraft unser Lernen und unsere Beziehungen verändert

Eine neue Studie zeigt: Schon positive Gedanken können Vorlieben formen, Lernen fördern und Veränderungen im Gehirn anstoßen
Sich eine schöne Begegnung mit einem Menschen vorzustellen, kann tatsächlich dazu führen, dass wir diesen Menschen sympathischer finden. Das zeigt eine neue Studie der University of Colorado Boulder und des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften. Entscheidend ist dabei: Unser Gehirn verarbeitet vorgestellte Erfahrungen ähnlich wie reale Erlebnisse.
Lernen ohne echte Erfahrung
Die Forschenden konnten nachweisen, dass lebhafte Vorstellungen messbare Veränderungen im Gehirn auslösen. Regionen, die für Lernen, Motivation und Präferenzbildung zuständig sind, werden aktiviert – selbst dann, wenn die Situation nur im Kopf stattfindet. Das eröffnet neue Perspektiven für Lernprozesse, persönliche Entwicklung und soziale Beziehungen.
Vorstellungskraft ist kein passiver Prozess
„Wir zeigen, dass wir aus rein imaginären Erfahrungen lernen können“, erklärt Studienleiter Prof. Roland Benoit. Die gleichen neuronalen Mechanismen, die beim Lernen aus realen Erfahrungen wirken, sind auch bei vorgestellten Situationen aktiv. Vorstellungskraft ist damit kein bloßes Tagträumen, sondern ein aktiver Prozess, der Erwartungen und Entscheidungen beeinflusst.
Gedächtnis und Zukunftsbilder hängen eng zusammen
Bereits frühere Studien zeigten, dass Erinnern und Vorstellen dieselben Gehirnareale nutzen. Kinder entwickeln beide Fähigkeiten ungefähr im gleichen Alter, ältere Menschen verlieren sie oft parallel. Wer Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis hat, tut sich häufig auch schwer, sich neue Situationen vorzustellen. Daraus entstand die Frage: Können wir allein durch Vorstellung lernen?
Das Experiment im Gehirnscanner
Um das zu überprüfen, nahmen 50 Erwachsene an einer Studie mit funktioneller Magnetresonanztomografie (fMRT) teil. Zunächst sollten sie bekannte Personen nach Sympathie bewerten. Anschließend stellten sie sich im Scanner positive oder negative Erlebnisse mit neutral bewerteten Personen vor – etwa ein gemeinsames Eisessen oder eine enttäuschende Erfahrung.
Wenn das Gehirn überrascht wird
Besonders spannend war der sogenannte Belohnungsvorhersagefehler. Wenn eine vorgestellte Situation positiver ausfiel als erwartet, reagierte das Gehirn mit verstärkter Aktivität im ventralen Striatum – einer Region, die auch bei realen Belohnungen aktiv ist. Gleichzeitig arbeitete dieser Bereich mit Gedächtnisregionen zusammen, die für Personenwissen zuständig sind.
Positive Vorstellungen stärken Sympathie
Nach dem Experiment mochten die Teilnehmenden jene Personen mehr, mit denen sie sich häufiger positive Erlebnisse vorgestellt hatten. Allein das innere Bild reichte aus, um die emotionale Bewertung zu verändern. Negative Vorstellungen hatten dagegen keinen vergleichbar starken Effekt.
Bedeutung für Lernen, Therapie und Alltag
Die Ergebnisse sind für viele Lebensbereiche relevant. In der Psychotherapie könnten belastende Situationen zunächst gedanklich geübt werden, statt sie real durchzuleben. Auch im Lernen, im Sport oder in der Musik ist mentales Training schon lange bekannt – nun gibt es dafür eine klare neurobiologische Erklärung.
Chancen – und Grenzen – der Vorstellungskraft
Gleichzeitig weist die Studie auf Risiken hin. Menschen mit Angststörungen oder Depressionen neigen dazu, negative Szenarien besonders lebhaft auszumalen, was ihre Belastung verstärken kann. Vorstellungskraft kann also sowohl hilfreich als auch problematisch sein – je nachdem, wie sie genutzt wird.
Ein einfacher Gedanke mit großer Wirkung
Die zentrale Erkenntnis lautet: Wer sich positive Begegnungen, Lernerfolge oder Beziehungen bewusst vorstellt, kann reale Veränderungen anstoßen. Unser Gehirn unterscheidet weniger strikt zwischen Vorstellung und Wirklichkeit, als lange angenommen wurde – und genau darin liegt sein großes Potenzial.
Originalpublikation
Aroma Dabas, Rasmus Bruckner, Heidrun Schultz, Frederik Bergmann & Roland G. Benoit
“Learning from imagined experiences via an endogenous prediction error”
Nature Communications
https://www.nature.com/articles/s41467-025-66396-2