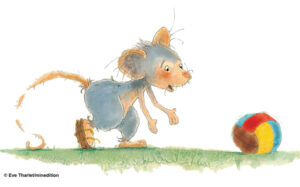Fingerzählen unterstützt das kindliche Zahlverständnis – und eröffnet einen natürlichen Zugang zur Mathematik
„Nicht mit den Fingern!“ – dieser Satz begegnet vielen Kindern schon in der ersten Klasse. Dabei zeigt die aktuelle Forschung, dass Fingerzählen ein zentraler Baustein im frühen Mathematiklernen ist. Die kognitive Entwicklungspsychologin Prof. Catherine Thevenot und ihre Kollegin Justine Dupont-Boime untersuchen seit Jahren, wie Kinder Zahlen verstehen und welche Rolle der eigene Körper dabei spielt. Ihre Forschungsarbeiten, vorgestellt im Magazin Cerveau & Psycho, zeigen eindrucksvoll, wie eng Fingerwahrnehmung und mathematisches Denken miteinander verknüpft sind.
Die Wissenschaftlerinnen arbeiten am Laboratoire du Cerveau et du Développement Cognitif (LABCD), einer Forschungseinheit, die sich mit der Entwicklung numerischer Fähigkeiten bei Kleinkindern beschäftigt. Dabei interessiert sie besonders, wie Kinder Finger als Werkzeug nutzen, um Mengen zu begreifen und einfache Rechenaufgaben zu lösen – eine Strategie, die weit natürlicher ist, als viele Erwachsene vermuten.
Wie Finger und Zahlen im Kopf zusammengehören
Einen besonders eindrucksvollen Hinweis auf diese Verbindung liefert ein Fall aus dem Jahr 1964: Ein elfjähriges Mädchen, das ohne Unterarme geboren wurde, berichtete, dass es „an seinen Fingern“ zählen könne – obwohl diese gar nicht existierten. Sie legte ihre imaginären Hände auf den Tisch und erfühlte beim Rechnen jeden einzelnen Finger. Wissenschaftlich spricht man hier von digitaler Gnosie, der Fähigkeit, die eigenen Finger mental präzise wahrzunehmen. Genau diese Fähigkeit, so zeigen zahlreiche Studien, hängt eng mit den späteren mathematischen Leistungen zusammen.
Kinder, deren Fingergnosie besonders ausgeprägt ist, haben nicht nur ein besseres Gefühl für Mengen, sondern schneiden auch in Mathematiktests langfristig überdurchschnittlich ab. In Experimenten mit Vorschulkindern zeigte sich, dass jene, die mit geschlossenen Augen genau benennen konnten, welcher Finger sanft berührt wurde, ein Jahr und sogar drei Jahre später deutlich besser rechneten als ihre Altersgenossen. Die Finger dienen gewissermaßen als körperliche Landkarte für Zahlen – ein intuitives System, auf das Kinder zurückgreifen, lange bevor sie abstrakte Symbole sicher beherrschen.
Warum Fingerzählen den Einstieg erleichtert
Die Erklärung dafür ist erstaunlich klar: Kinder, die ihre Finger gut spüren und nutzen, können Zahlen leichter mit bestimmten Fingerstellungen verknüpfen. Die Zahl 4 hat plötzlich eine Form, die man anfassen kann; die Zahl 7 entsteht aus fünf Fingern der einen und zwei Fingern der anderen Hand. Rechnen wird damit nicht zu einer abstrakten Pflichtaufgabe, sondern zu einer körperlich erfahrbaren Handlung.
Kinder mit schwächerer Fingergnosie greifen seltener auf dieses körperliche Zahlengedächtnis zurück. Genau diese Kinder haben oft größere Schwierigkeiten, Mengen zu vergleichen oder einfache Additionen zu lösen – ein Unterschied, der sich später im Mathematikunterricht deutlich bemerkbar machen kann.
Die Klügsten beginnen als Erste damit
Besonders spannend ist, dass Thevenot und Dupont-Boime in ihren Studien nicht etwa jene Kinder häufiger beim Fingerzählen beobachteten, die unsicher sind oder Unterstützung brauchen. Im Gegenteil: Es waren gerade die leistungsstärksten Kinder, die früh und selbstbewusst auf ihre Finger als Hilfsmittel zurückgriffen. In Versuchen mit versteckter Kamera arbeiteten die klügsten Fünf- und Sechsjährigen am häufigsten mit ihren Fingern, wenn sie einfache Additionen lösen sollten.
Diese Kinder fanden aber auch schneller wieder zu abstrakteren Rechenwegen. Das deutet auf ein natürliches Entwicklungsfenster hin, in dem Fingerzählen besonders sinnvoll ist – ungefähr um das sechste Lebensjahr herum. Danach entwickeln Kinder automatisch Strategien, bei denen sie Zahlen auswendig abrufen oder Mengen rein mental vergleichen können.
Warum Fingerzählen im Unterricht mehr Raum haben darf
Trotz der klaren Befunde gilt Fingerzählen in vielen Klassenzimmern als überholt oder peinlich. Manche Kinder verstecken ihre Hände unter dem Tisch, um nicht aufzufallen, oder fragen verlegen nach Erlaubnis. Dabei sprechen sowohl entwicklungspsychologische als auch neuroanatomische Erkenntnisse dafür, diese natürliche Strategie zu unterstützen.
Bildgebende Studien zeigen, dass sich Gehirnareale für Fingerwahrnehmung und Zahlenverarbeitung überlappen. Wird die Aktivität dieser Regionen künstlich gestört, beeinträchtigt dies sowohl die Fähigkeit, Finger zu spüren, als auch die Fähigkeit, Zahlen zu vergleichen. Das Gehirn arbeitet hier also in einem gemeinsamen Netzwerk – ein Netzwerk, das Kinder intuitiv nutzen, wenn sie an ihren Fingern abzählen.
In historischen Quellen zeigt sich zudem, dass das Fingerzählen jahrhundertelang elementarer Bestandteil mathematischer Bildung war. Arithmetikbücher galten erst dann als vollständig, wenn sie das Rechnen mit den Fingern erklärten. Die enge Beziehung zwischen Zahl und Körper war selbstverständlich – und verlor sich erst mit der zunehmenden Schulabstraktion.
Wie man Kinder beim Fingerzählen begleitet
Das Forschungsteam arbeitet inzwischen an einem Lernprogramm für Kinder, die diese hilfreiche Strategie nicht von selbst verwenden. Dabei lernen Kinder zunächst, Mengen eindeutig mit bestimmten Fingerstellungen zu verbinden, später werden diese Muster automatisiert. Im nächsten Schritt üben sie, zwei Zahlen über Fingerbilder zu einer Summe zusammenzuführen – etwa indem sie 3 auf einer Hand und 5 auf der anderen zeigen. Schließlich entwickeln sie Strategien, bei denen sie von der größeren Zahl ausgehen und nur die kleinere über die Finger ergänzen.
Diese Vorgehensweise zeigt, wie eng körperliche Erfahrung und mathematisches Denken miteinander verflochten sind. Wenn Kinder ihre Finger nutzen dürfen, entsteht ein natürlicher Zugang zu Zahlen, der ihnen eine stabile Grundlage für alle weiteren Lernschritte bietet. Gerade in einer Welt, in der Mathematik in nahezu allen Lebensbereichen eine Rolle spielt, lohnt es sich besonders, diese körpernahe Form des Lernens ernst zu nehmen und zu unterstützen.